|
FORUM DEUTSCH ISSN 0843-9829-X 13. Jahrgang Herbst 2004
Für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer
in Kanada
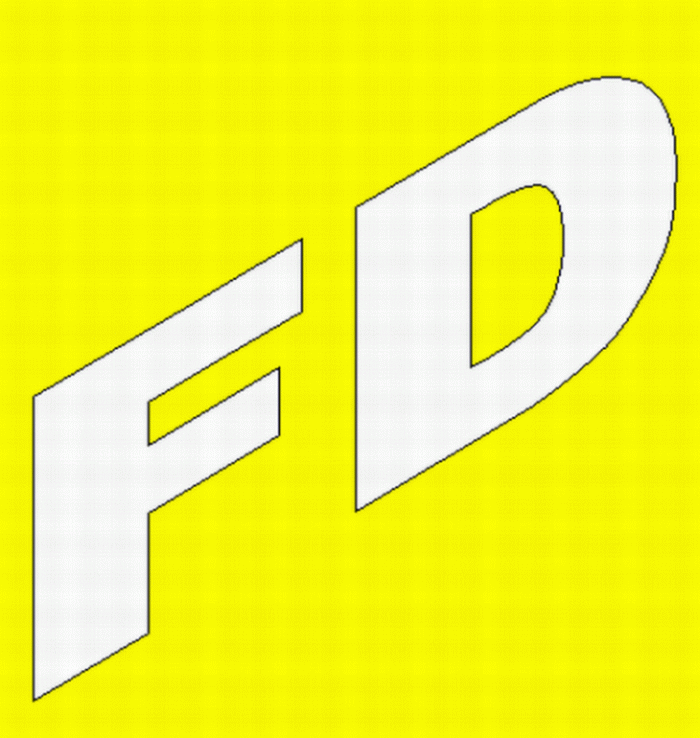 Publikationen - Informationen - Arbeitshilfen - Diskussionen - Tipps Herausgeber:
Redaktion
dieser Nummer: Redaktionelle
Vertreter: Beiträge und Kommentare auf Deutsch, Englisch oder Französisch senden Sie bitte an folgende Adresse: ls@montreal.goethe.org Format: Dateien im Format Word oder WordPerfect UNFORMATIERT. Abbildungen, Zeichnungen oder Fotografien können nur von der Originalvorlage abgedruckt werden. Etwaige Copyright-Erlaubnis muss vom Autor eingeholt werden. FORUM DEUTSCH ist die Zeitschrift der CATG und wird durch die finanzielle Unterstützung des Goethe-Instituts ermöglicht. Dezember 2004 INHALT Vorwort der PräsidentinAUS DEM VERBANDSLEBEN DER CATG Der CATG-Vorstand stellt sich vor Dr. Cheryl Dueck, CATG-Präsidentin Herb Martens, CATG-VizePräsident Call for Papers KULTUR UND UNTERRICHT Bakeries and Bratwurst? The Image Problem of Germany and Germans in New Brunswick Cheryl Dueck, Fredericton Deutsch nur als Heilige-Schrift-Sprache? Hutterer in Kanada und die deutsche Sprache Jana Binder, Toronto Kabarett Weimar: L’intégration d’un thème culturel dans l’enseignement de l’allemand Nathalie Lachance, Montréal Was heißt hier Pop? Zur Inszenierung der Popliteratur Konstanze Kendel, Wolfville Trotz sprachlicher Schranken im Dialog. Künstleraustausch zwischen Quebec und Bayern Jürgen Heizmann, Montreal Quiz zum neueren deutschen Film Wolfgang Krotter, Montreal Text und Theater: Brecht im Sprachunterricht Jill Scott, Kingston Interview mit der Autorin Jana Hensel Katja Thelen und Christian Weiß, Montréal MULTIMEDIA UND UNTERRICHT GOOGLE-Geheimnisse: Tipps zur effizienteren Suche Susanne Kruse, Montréal Virtuelle Links zu „Deutsch als Fremdsprache“ Britta Morzick, Toronto Neues aus der virtuellen Welt Wolfgang Krotter, Montreal SPRACHWISSENSCHAFT, DIDAKTIK, METHODIK, PÄDAGOGIK UND UNTERRICHT Drama Pedagogy in the Language Classroom: A Workshop Kim Fordham, Edmonton Learning grammar in German 100: one way to understanding English grammar? Ulf Schütze, Vancouver Des Klassenzimmers großes Welttheater. Der “Ohrenzeuge“ und “Wer war Mozart?” an der Wilfrid Laurier Universität Alexandra Zimmermann, Waterloo Die Muttersprache als Sprach-Mutter: ein Gegenentwurf zur herrschenden Theorie Wolfgang Butzkamm, Aachen BERICHTE,
VERBÄNDE,
INSTITUTIONEN André Oberlé, Winnipeg Traum und Wirklichkeit Jogging im Schlosspark Schönbrunn. Mein Sprach-Rendezvous in Wien 2003 Luciana Popp, Edmonton Bericht über die KVDS-Fortbildungskonferenz in Vancouver. 14.-16. Mai 2004 Ilona Beck und Christine Hörger, Rouleau APAQ-Bericht zur CATG – Sonntag den 8.2.2004 Marie-Josée Martineau, Montréal BCCTG-Jahresplan Axel Rechlin, Vancouver CAUTG-Bericht an die CATG Rüdiger Mueller, Guelph Von Schlafmünzen und Peanuts: Quiz zu den Wörtern des Jahres Wolfgang Krotter, Montreal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Places of Birth | 1996 |
2001 |
| TOTAL | 24 380 |
22 470 |
| United States | 8 925 |
7 955 |
| United Kingdom | 6 410 |
5 300 |
| Germany | 1 750 |
1 575 |
| Netherlands | 865 |
810 |
| India | 470 |
390 |
The second is that some of the more recent large immigrant groups from Asia to Canada are virtually absent from New Brunswick, and that the German immigration is still comparatively important. This stands out when we compare the figures from before 1961 and recent immigration.
Pre-1961 |
Recent | |
| TOTAL | 6 410 |
24 380 |
| United States | 1 385 (2) |
8 930 (1) |
| United Kingdom | 3 085 (1) |
6 410 (2) |
| Germany | 430 (4) |
1 750 (3) |
| Netherlands | 505 (3) |
870 (4) |
| China | ? (?) |
525 (5) |
| India | ? (?) |
470 (6) |
| Viet Nam | ? (?) |
300 (7) |
| Ireland (Eire) | 150 (5) |
290 (8) |
| Italy | 125 (6) |
260 (9) |
| Hong Kong | ? (?) |
195 (10) |
Germany is still third after the United States and the United Kingdom. Stats Canada statistics also show the self-declared ethnicity of citizens in New Brunswick’s largest cities. In Fredericton, we see that German ethnic origin ranks only after Canadian, French and various national groups from the UK.
| 2001 | Total |
2001 in % | 1996 in % |
| Canadian | 20 615 |
43.86 |
34.77 |
| English | 15 795 |
33.61 |
42.46 |
| Scottish | 13 470 |
28.66 |
30.09 |
| Irish | 12 240 |
26.04 |
26.45 |
| French | 7 915 |
16.84 |
18.62 |
| German | 2 570 |
5.47 |
5.73 |
| Dutch | 1 405 |
2.99 |
3.72 |
| Welsh | 1 165 |
2.48 |
2.62 |
| N.A. Indian | 1 070 |
2.28 |
2.23 |
| Acadian | 695 |
1.48 |
1.02 |
This is true for Moncton and Saint John as well. The main difference among the three largest cities in New Brunswick is the Acadian ethnic identification in Moncton.
The appeal of New Brunswick for contemporary Germans, both as tourists and as prospective immigrants, is often simply a question of geography. New Brunswick is approximately the same size as Bavaria in square kilometres, and yet Bavaria has some nine million inhabitants to New Brunswick’s three quarters of one million. The nature and culture of the Canadian Maritime region is a considerable draw for German tourists, and a number of successful companies, run by Germans or German immigrants, serve these tourists especially in northern New Brunswick. These include Frank’s Canada Tours, part of the Morada Hotel group, and Skan-Tours bus trips. Frank’s Canada Tours and Skan-Tours both cater to the 60-plus age group and run tours through Canada, including the Maritimes, to the Acadian Historical Village and King’s Landing, among other destinations. Before September 11, they served around 4,000 tourists per year, but the number has dropped off drastically, albeit likely only temporarily. Frank’s Canada Tours and Skan-Tours have an agreement with James Cook Travel that runs a charter air service from Hannover to Moncton, and from Moncton to Hannover via Toronto, specifically to serve tour groups. Sport fishers from Germany find the salmon fishing on the Miramichi river to be a premier destination, and there are fishing lodges there who employ German-speaking staff during the summer season. Germans have longer vacation time than North Americans and are known to be among the biggest supporters of the tourist industry in Canada. One of my colleagues, Marianne Eiselt, who teaches German language courses at University of New Brunswick, identified a market gap in tourist guides and information about the province. Together with her husband Horst A., a faculty member at UNB, they have published a number of books, including a hiking guide and photo collection. The Eiselts’ books are published in English, but are targeted in part at German tourists.
The Government of New Brunswick has recognized the importance of immigration from Germany, among other places, and actively recruits entrepreneurs. Tony Lampart from the Government of New Brunswick informed me that the province signed the New Brunswick Provincial Nominee Program (PNP) agreement with the federal government in 1999. Under this agreement, the provincial government has increased input in the selection of economic immigrants. The final immigration decision rests with the federal government. Germany is one of the countries where New Brunswick actively seeks immigrants who are either self-employed entrepreneurs, or skilled workers needed by New Brunswick employers. In addition to promotional materials in Mandarin and Korean, the Government of New Brunswick immigration website features a German language brochure (http://www.govnb.ca/immigration). Since 1999, New Brunswick has received 23 applications through the PNP program from immigrants and their immediate families from Germany: about 70% entrepreneurs, and 30% skilled workers. In the same time period, the program has processed a total of 255 applications from 39 different countries. At present, applications from Germany rank third in number. Lampart informed me that over the past five years, the interest by potential German immigrants to consider New Brunswick as a place to work and live has been steady. Right now, the interest seems to be slightly higher than a few years ago. On an annual basis, the PNP program organizes two to four promotions in Germany, which consist of one-on-one sessions with pre-screened candidates. On the average, they meet with fifteen potential immigrants in each session. All of these figures show that entrepreneurs and skilled workers from Germany continue to be highly valued in the New Brunswick economy, but their impact is not immediately recognizable by the population. Exports to Germany are increasing in 2004, which shows that the trade relationship between the province and Germany is not diminishing in importance. [3] Within this context then, German language skills and cultural knowledge are of great value. Canadian companies with international connections are particularly interested in potential employees with skills in these areas. There is an identifiable need for university education in German Studies, and I will now address the history of German Studies at the provincial university.
The University of New Brunswick was founded as a university in 1859 on the grounds of King’s College–the oldest English language university in Canada, founded in 1785. At that time, German was one of the first subject areas to be named by the University’s Faculty of Arts. Michael Batts’ invaluable Brief Survey of Germanic Studies at Canadian Universities provides a number of details about University of New Brunswick’s German program, as well as about enrolment in German courses nationally. There was a Distinction and Honours Course at UNB, that is, an Honours Degree Program, in place by at least 1898, and probably earlier, according to archival records (28). One may compare this to the British context by noting that Oxford did not establish degree courses in German until 1903. Modern languages were slow to take hold in the university context generally, and Canada’s universities were relatively early in this regard. Examination lists for university programs show that German and French were both elements of a general degree program in the mid to late nineteenth century. Enrolment in German at Canadian universities, contrary to what one might expect, rose steadily before the two world wars, and declined only moderately during the Second World War. It was presented as a useful language in the political environment, and, after all," The subject is not compulsory, and any student who finds he is in danger of learning to admire the Germans can at once change to another subject” (1919, UBC Outline of Courses, qtd. in Batts, 88). Most universities experienced quite a sharp increase in German enrolments after the war. In the 1950s, German was affected by the introduction of courses in other modern languages, such as Italian and Spanish, and particularly by Russian, introduced since the 1940s and of considerable political interest in the 1950s. The peak years for German enrolment at Canadian universities were 1962–65.This corresponds with a sudden increase in overall student population, as the children of the 'baby boom' years began to enter the university. Many new faculty members were hired at this time, and many of my colleagues now nearing or entering retirement were recruited directly from Germany, offered a university position sight unseen. By the late 1960s, German programs were affected by the student revolt against what were seen as unnecessarily restrictive requirements, one of which was the foreign language requirement. Responses of the universities to that protest varied. The language requirement could be abolished, reduced or retained. In most cases, the foreign language requirement was retained for Arts students. The availability of and interest in other languages, however, resulted in a very significant decline of enrolments in German courses in the 1970s. Numbers rose again gradually in the 1980s, spiked briefly and fell back after German unification, have shown a gradual increase in the past five years, but have not returned to the high levels of the 1960s. (The above information is summarized from Batts’s study, pp. 83-94, and from recent data from CAUTG enrolment reports: http://www.mun.ca/german/German/CAUTG/2004.1/table02.html.)
In many German departments, faculty numbers have been cut drastically since the peak in the 1960s. At the University of New Brunswick, the German faculty has shrunk from a high of seven professors to the current two professors. The reduction in faculty numbers has been due in large part to funding challenges of the universities and a low prioritization of foreign languages and cultural studies by university administrations. We are faced with the contradictory messages that, on the one hand, our universities seek increased internationalization and, on the other, that there is no money for full-time instructors or professors of language and culture. Language and cultural training have been, in many instances, excluded from the rhetoric and practice of internationalization at the university. In many cases, internationalization has come to be associated predominantly with the—certainly valuable—research cooperation of scientists and engineers, or with the recruitment of international students who pay higher fees to the university. Enrolment and hiring patterns go hand-in-hand; our German professors have been ageing, and while there has been some rejuvenation in recent years with new hirings, the overall number of faculty has shrunk drastically. At UNB, this has certainly meant that fewer courses can be offered, and that there are therefore fewer students taking German.
At the University of New Brunswick, students in the Faculty of Arts are currently required to take either a foreign language or a science course, but for only two semesters. Most of the students do choose to take a language course, which means that in the Culture and Language Studies Department there is enormous demand for sections of first-year language in German and Spanish. This drops off sharply after first year, and the Department is faced with the challenge of staffing those first year sections and offering a viable German Studies program through four years of study. As I mentioned, foreign language departments across the country face this challenge, since students do not immediately see the connection of cultural and linguistic knowledge to their employment future. There have been a number of responses to this problem. One effective response has been the introduction of German and foreign language cultural studies courses offered in English, rather than in German as in the past. At UNB, students can take courses on German culture, German film, German literature in translation, and thematically based team-taught courses on aspects of international literatures and cultures. These kinds of courses serve to reach a larger number of students, majoring in a broad range of disciplines, as documented by enrolment statistics at the national level (see http://www.mun.ca/german/German/CAUTG/2004.1/table8.html). They are able to develop cultural fluency in a new way that can serve German majors and non-majors very well in a variety of contexts. Importantly for the public impact of the department, they are compatible with the broader university agenda of internationalization.
I mentioned earlier that German programs have increasingly had to compete with other language programs for students, and recently, Spanish has experienced much growth. Students who elect to focus on one foreign language are often encouraged by the widespread perception is that Spanish is increasingly valuable and necessary for international communication, especially since the North American Free Trade Agreement was implemented. While this is certainly true, Germany and Mexico have a very similar trading status with Canada (Germany is Canada’s fifth-largest export market and sixth-largest import market; Mexico is sixth for export and fourth for import—Statistics Canada, June 2004). However, the relationship with Germany is not always as visible.
The title of my paper referred to
the Image Problem of Germans and Germany in New Brunswick.
It is historically
demonstrable that German immigrants have been highly successful at
assimilating into their new homes,
and in New Brunswick,
this has resulted in the considerable underestimation
of the German cultural contribution to the province.
In turn, New Brunswickers are missing out on opportunities to
develop
and strengthen the existing ties with Germany.
International
cooperation requires a cultural and linguistic literacy that must
be fostered within the educational and governmental institutions.
Our hope is that the exchange program that was signed by
New Brunswick and the Saarland will result in an increased flow
of students and ideas between these regions,
and that this will
be a positive step in the development of intercultural knowledge.
NOTES
[1] In 2003, the second highest export commodity from New Brunswick to Germany was silver ($7.8 million).
[2] All demographic statistics cited here are available online, and searchable by title, at http://www.statcan.ca.
[3] Exports of chemical wood pulp for January-August 2004 totalled $31.3 million. This is an increase of 25.7% over the same period in 2003, according to Business New Brunswick.
WORKS CITED
Batts, Michael S., A Brief Survey of Germanic Studies at Canadian Universities from the Beginnings to 1995. Bern: P. Lang, 1998.
Canada. Statistics Canada, 2001 Census of Canada (http://www12.statcan.ca/english/census01/home/index.cfm).
Canada. Statistics Canada, 1996 Census of Canada (http://www12.statcan.ca/english/census01/info/census96.cfm).
Eiselt, Marianne & H.A. Eiselt, Discovering New Brunswick. Halifax: Formac Publishing Co. Ltd., 2002.
Eiselt, Marianne & H.A. Eiselt, A Hiking Guide to New Brunswick, 2nd edition. Fredericton: Goose Lane Editions, 1996.
Hempel, Rainer L., New Voices on the Shores: Early Pennsylvania German Settlements in New Brunswick. Toronto: German-Canadian Historical Association, 2000.
Lampart, Tony, "German immigrants." E-mail to Cheryl Dueck. 4 June 2003.
Richard, D., “New Brunswick Trade With Germany.” 23 Aug. 2004. Report provided in an e-mail from Pierrette Battah, Business New Brunswick/Entreprises Nouveau-Brunswick, 4 Nov. 2004.
Deutsch nur als Heilige-Schrift-Sprache? Hutterer in Kanada und die deutsche Sprache
Jana Binder, Toronto
„Ich möchte dem Goethe-Institut herzlich danken, daß Ihr’s mir ermöglicht habt, meinen Wunsch, eine Reise nach Deutschland, zu erfüllen. Ich glaube, daß viele Hutterer diesen Traum haben, und es ist wirklich das Schönste, was einer Deutschschülerin wie mir zuteil werden könnte“, schreibt die 18jährige Evelyn Maendel nach einem Sprachkursstipendium in Berlin. Evelyn Maendel lebt auf dem Fairholm Bruderhof in Manitoba und ist Teil der Gemeinschaft der Hutterer, von denen viele zwischen 1528 und 1621 aus dem deutschsprachigen Raum flohen und nach Stationen in Ungarn, Rumänien, Russland und den USA nun seit 1918 in Kanada leben.
„Das vergessene Volk“ nannte Michael Holzach die Hutterer in seinem Buch, das sein Leben auf zwei Bruderhöfen Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts beschreibt. Und in der Tat – Nachfragen in Deutschland und Kanada zeigen, dass kaum jemand bisher von Hutterern gehört hat. Amische, Mennoniten – das ist vielen Menschen ein Begriff. Und auch die freie Enzyklopädie Wikipedia kennt nur Amische und Mennoniten unter den Stichworten deutsche Sprache und Minderheiten. Aber Hutterer?
Wer sich beruflich mit deutschsprachigen Minderheiten in aller Welt auseinandersetzt oder sich für die Verbreitung der deutschen Sprache in Kanada interessiert, bzw. in den ländlichen Regionen der kanadischen Provinzen Manitoba, Alberta oder Saskatchewan lebt, ist hier schon wissender. Dennoch, vom Alltag in den Kolonien oder den neuen Bemühungen der Hutterer, sich die deutsche Sprache intensiver anzueignen, ist selbst in Kreisen, die sich professionell mit der Verbreitung der deutschen Sprache in Kanada beschäftigen, wenig bekannt.
Der folgende Artikel ist keine Ergebnisstudie einer Forschung über Hutterer (wovon es übrigens eine beträchtliche Anzahl gibt), sondern soll Deutschlehrer und Germanisten in Kanada dazu anregen, sich eingehender mit diesen Menschen und ihrer Lebensweise als Teil der deutschkanadischen Geschichte, Lebens und Sprachwelt auseinanderzusetzen.
Hutterer in Kanada
Auch wenn immer wieder generalisierend über ‚Hutterer’ gesprochen wird, so ist es wichtig anzuerkennen, dass hier zwischen sehr unterschiedlichen Gruppen differenziert werden muss, die zum Teil sehr verschiedene Auffassungen darüber haben, was es bedeutet Hutterer zu sein. Samuel Hofer, der als Hutterer geboren wurde und die Kolonie, in der er aufwuchs, mit 20 Jahren verließ, unterscheidet und charakterisiert die Gruppen wie folgt: Die Lehrerleit, die vor allem in Alberta leben, sind die konservativste Gruppe, die sich bisher am erfolgreichsten in der Bewahrung ihrer Traditionen zeigte. Dieser Gruppe gegenüber stehen die Schmiedeleit, die am progessivsten sind, insbesondere was die Schulbildung ihrer Kinder und den Handel betrifft. Die Dariusleit sind, nach Hofer, ungefähr in der Mitte anzusiedeln. Allerdings sind auch diese drei Untergruppen nicht homogen. So haben sich zum Beispiel die Schmiedeleit 1992 wiederum in zwei Gruppen unterteilt, wie auf der Webseite http://www.hutterites.org, einer Selbstdarstellung der Schmiedeleit, zu lesen ist. Die Meinungsverschiedenheiten, die zu dieser Teilung führten, konnten bis heute nicht behoben werden, und die beiden Untergruppen leben in Zwietracht.
Von dieser Situation ausgehend, erscheint es fast unmöglich, einen Artikel über Hutterer im Allgemeinen zu schreiben. Ich will dennoch versuchen, die gemeinsame Geschichte und den gemeinsamen Hintergrund, vor welchem sich die einzelnen Bruderhöfe ausdifferenzieren, darzulegen. Nur so scheint es möglich, auch die inneren Differenzierungen, vor allem in Bezug auf den Umgang mit der deutschen Sprache, zu verstehen.
1874 gilt offiziell als das Jahr, in dem die Emigration der hutterischen Dariusleit und der Schmiedeleit nach Nordamerika stattfand. Grund für diese Entscheidung war der Erlass eines Dekrets in ihrem damaligen Siedlungsgebiet der Ukraine, nach welchem sich auch die Hutterer verpflichten mussten, ihre Kinder in russische Schulen zu schicken sowie den Militärdienst zu absolvieren.
In den folgenden drei Jahren erreichten, neben vielen Mennoniten, um die 1.265 Hutterer (zuletzt die Lehrerleit) New York. Um die 400 Hutterer ließen sich in Kolonien in South Dakota nieder und begannen dort sehr erfolgreich zu wirtschaften.
Der nun endlich erreicht geglaubte Frieden währte jedoch nicht lang, denn der Ausbruch des Ersten Weltkrieges produzierte eine feindselige Stimmung unter der ansässigen amerikanischen Bevölkerung gegenüber den Siedlern, die sich nicht nur anders kleideten und eine andere Sprache sprachen, sondern auch entschlossene Pazifisten waren. Die deutsche Sprache wurde daraufhin offiziell verboten, was für die Hutterer vor allem bedeutete, ihr Glaubensbekenntnis nicht mehr leisten zu können. Mehrere Männer wurden in Gefangenschaft genommen und gefoltert, da sie den Dienst an der Waffe sowie das Tragen von Uniformen verweigerten. Unter diesen Umständen erwogen viele Hutterer, nur wenige Jahrzehnte nach ihrer Emigration in die USA, auch das Land der großen Freiheit wieder zu verlassen. Bis heute gibt es in den USA aber immer noch (und zum Teil wieder) zahlreiche Bruderhöfe.
Da Kanada Anfang des 20. Jahrhunderts großes Interesse an einer Bewirtschaftung der bisher ungenutzten Prärie hatte und die Hutterer als erfolgreiche Farmer bekannt waren, wurde ihnen versichert, dass sie, einmal in Kanada angekommen, keine Restriktionen mehr zu erwarten hätten. Viele Hutterer entschieden daraufhin, ein weiteres Mal alles hinter sich zu lassen und in einem neuen Land, in Frieden und Einklang mit ihrem Glauben und ihrer Lebensweise, Kolonien aufzubauen. Das Versprechen der Regierung stieß allerdings schon bald auf den Unmut der kanadischen Gemeinden, in deren Nähe sich die Kolonien ansiedelten. Diese sahen sich übervorteilt durch die angeblichen Privilegien, die den Hutterern zugesprochen wurden. Unter dem Druck der örtlichen Bevölkerung musste das Versprechen uneingeschränkter Einwanderung von der kanadischen Regierung bald wieder zurück genommen werden. Die Feindseligkeiten gegenüber Mitgliedern der Hutterer gingen in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg etwas zurück, denn während der Rest der Bevölkerung unter der großen Depression litt, waren die autark agierenden Hutterer besser in der Lage, ihr Überleben zu sichern. Hutterer waren im Gegensatz zu vielen anderen nicht auf staatliche Hilfe angewiesen und sogar in der Lage Steuern zu zahlen.
Während des Zweiten Weltkrieges wandelte sich die Akzeptanz allerdings wieder in eine offene Ablehnung. Dies stand, wie nur knapp zwei Jahrzehnte zuvor, in engem Zusammenhang mit der Ablehnung der Hutterer, für das neue Vaterland in den Krieg zu ziehen. Das staatliche Versprechen der Befreiung vom Militärdienst wurde diesmal aber nicht gebrochen. Hutterer und andere religiöse Gemeinschaften wurden von der kanadischen Regierung im Rahmen eines Ersatzdienstes verpflichtet. Dies war aber nicht der einzige Grund, warum sich Feindlichkeiten gegenüber den Bruderhöfen entwickelten. Viel mehr verärgerte und verängstigte die weltlichen Nachbarn die Expansion der hutterischen Gemeinden.
Wiederum wurde dem Druck der Bevölkerung von staatlicher Seite nachgegeben und ein Gesetz erlassen, welches festlegte, dass kein Land mehr an Hutterer verkauft werden durfte (Land Sales Prohibition Act), keine neuen Kolonien in einem Radius von 40 Meilen von einer bereits existierenden Kolonie errichtet werden durften und keine Kolonie in Zukunft mehr als 6,400 Hektar besitzen durfte. Die Restriktionen in Bezug auf die Besiedelung von Land in den Provinzen Manitoba und Alberta machten eine weitere Ausbreitung in die Provinz Saskatchewan nötig. Trotz dieser Restriktionen wurde in den 40er Jahren im Durchschnitt eine Kolonie pro Jahr gegründet.
Erst die offizielle Gründung und Registrierung der Hutterer als Kirche (Hutterite United Brethren Church) im Jahr 1950 ermöglichte einen besseren Schutz und das Einklagen von Rechten. Das Gesetz, das die Ansiedlung für Hutterer erschwerte, wurde 1960 aufgehoben aber mit der Bedingung versehen, dass jeder Landverkauf neunzig Tage öffentlich ausgeschrieben sein musste, bevor Hutterer den Zuschlag bekommen. In einer Überprüfung der Gesetze wurde 1973 festgestellt, dass diese Gesetzgebung den Menschenrechten, wie sie 1966 in Kraft traten, widerspreche, und sie wurde ersatzlos gestrichen. Zur Zeit leben in Kanada und den USA nach Schätzungen der Gemeinschaft ungefähr 40.000 Hutterer in insgesamt 470 Kolonien. Insbesondere in Manitoba ist ihre Gegenwart in Geschäften, Restaurants und Bars alltäglich, und sie werden als progressive Farmer geschätzt.
Die Lebenswelt der Hutterer
Viele Gerüchte und Mythen umgeben die Hutterer und ihre Lebenswelt. Von unermesslichen Reichtümern, drakonischen Strafen bis hin zu Inzucht reicht die Palette der Mutmaßungen, mit welchen Samuel Hofer auf seinen Lesereisen immer wieder konfrontiert wird. Wie so oft entsprechen diese Aussagen nicht der Wahrheit. Auch lässt die zurückgezogene Lebenweise nicht gleichzeitig auf eine generelle Fortschritts und Technologiefeindlichkeit schließen, im Gegenteil! Auch wenn weniger der Profit, als vielmehr der Auftrag Gottes im Vordergrund steht, so werden in der Landwirtschaft die neuesten Technologien eingesetzt, um eine möglichst gute Ernte zu erzielen. Auch Internet und E-Mail sind Kommunikationsmedien, mit denen viele Hutterer durchaus vertraut sind, auch wenn Massenmedien prinzipiell eher auf Ablehnung stoßen, da sie den Einzelnen von der Gemeinschaft wegführen. Sobald eine Interaktion mit weltlichen Erfindungen allerdings dem eigenen Bruderhof und der Gemeinschaft nutzt, ist sie durchaus legitim, denn so wird das Überleben der Kolonien gesichert. Auch hier ist auf die bereits eingangs erwähnte Komplexität und Differenzierung zwischen den 470 verschiedenen Bruderhöfen hinzuweisen. Trotz des Austausches untereinander leben viele Höfe doch isoliert und folgen den Anweisungen des Predigers. Dadurch entwickeln sie sich, je nach Persönlichkeit des jeweiligen Predigers, unter Umständen sehr unterschiedlich bzw. legen die grundlegenden Statuten auf verschiedene Art und Weise aus.
Zu diesen grundlegenden Statuten gehören drei wichtige Elemente, die die Hutterer insgesamt von anderen Glaubensgemeinschaften unterscheiden:
- Güterteilung: Alle Güter werden innerhalb der Glaubensgemeinschaft geteilt; es gibt praktisch kein Privateigentum und keine Form der individuellen Entlohnung. Diese Säule unterscheidet die Hutterer von anderen Anabaptisten, wie z.B. den Amischen oder den Mennoniten. Hutterer sehen das Teilen materieller Güter als die höchste Form christlicher Nächstenliebe an.
- Gemeinschaft: Das eigene Interesse wird zu Gunsten der Harmonie des Bruderhofes immer zurückgestellt. Hutterer lernen schon als Kinder, sich der Gemeinschaft unterzuordnen und den Reichtum des größeren Familienkreises, die Geborgenheit, die Wärme und den Schutz, den er bietet, zu schätzen, und verzichten ihm zuliebe im Regelfall gern auf mehr individuelle Freiheiten.
- Abgeschiedenheit: Die große räumliche Entfernung symbolisiert nach innen wie nach außen einen Unterschied zwischen den Hutterern und „der Welt da draußen“ und ermöglicht es, die Einflussnahme der Welt auf den hutterischen Alltag möglichst gering zu halten. Kontakte können besser gelenkt und kontrolliert werden und die Gemeinschaft kann sich, ohne abgelenkt zu werden, auf sich selbst und ihre Lebens- und Glaubenswelt konzentrieren.
Die Bedeutung der deutschen Sprache in der hutterischen Gemeinschaft
Die meisten Hutterer sind heute trilingual. Sie sprechen innerhalb der Gemeinschaft Hutterisch, eine Sprache, die dem Dialekt des heutigen Kärntens in Österreich sehr ähnlich ist, wenn auch um viele Ausdrücke angereichert, die die Migrationsgeschichte widerspiegeln. In der Schule lernen sie Englisch, das sie für die Kommunikation mit der Außenwelt, wie zum Beispiel mit Ärzten und Geschäftspartnern, brauchen.
Deutsch oder besser frühes Neuhochdeutsch wurde lange Zeit vor allem aus der Bibel gelernt und deswegen auch als Heilige-Schrift-Sprache oder Kirchensprache bezeichnet.
Hutterer, die über 400 Jahre unter Verfolgung litten und immer wieder zur Emigration gezwungen waren, haben nichts mehr mit den Deutschen oder dem Deutschland des 20. Jahrhunderts gemein. Ursprünglich aus dem deutschsprachigen Raum stammend, verbindet sie ausschließlich die deutsche Sprache mit Deutschland. Allerdings ist diese, wie sie von den meisten Hutterern erlernt wird, eher charakteristisch für die Gedankenwelt und Weltsicht des europäischen Mittelalters als für die Gegenwart. Obwohl die deutsche Sprache im Alltag eine eher untergeordnete Rolle spielt, ist sie unabdingbar, drückt sie doch den Glauben und damit alle Richtlinien für ein hutterisches Leben aus. Grundlage ist die Sprache, in der Martin Luther die Bibel in das Deutsch der damaligen Zeit übersetzte. Deutsch ist die Sprache der Zeremonien und religiösen Akte und vermag nach Meinung der Hutterer ihren Glauben präziser auszudrücken, als es zum Beispiel das Englische könnte. Die deutsche Sprache wird somit zum Zentrum der Gottesdienste und Familienandachten und zu einem wichtigen Gut, da materielle Objekte gänzlich fehlen. Aus diesem Grund spielt auch die Verbalität zunächst eine wichtigere Rolle als die Literalität. Das Memorieren von Bibelsprüchen, Gebeten und vor allem auch Liedern war lange Zeit der Hauptbestandteil des Deutschunterrichts und ist es in konservativen Kolonien heute noch.
Die Sprachen Deutsch und Englisch standen hier dementsprechend lange Zeit symbolisch für verschiedene Welten: für die Kolonie, d.h. für die Religion, und für die Welt, d.h. das Profane. Diese symbolische Ordnung hat, ähnlich wie die Tracht, die Nahrung, die Freizeitgestaltung usw., zum Teil bis heute die Funktion, sich als Gruppe von der Außenwelt abzusetzen.
Die deutsche Sprache nimmt für Hutterer somit eine spezifische Rolle in der Hinwendung zur eigenen Kultur ein. Deutsch zu sprechen bedeutet, sich an die eigene Geschichte zu erinnern und so die alltäglichen Praktiken des Zusammenlebens und des Glaubens in einen größeren Kontext zu setzen. Aus diesem Grund bekommen die Kinder der Hutterer täglich vor und nach dem staatlichen Schulunterricht mit kanadischen Lehrern je eine Stunde Deutschunterricht, der von einem (in manchen Kolonien fachlich und methodisch nicht ausgebildeten) Gemeindemitglied erteilt wird. Für die Kinder erscheint das Erlernen der deutschen Sprache als notwendig, da sie sonst die Predigten, Lieder und Gebete, die einen wichtigen Teil des hutterischen Lebens ausmachen, nicht verstehen.
Wenn der Deutschunterricht allerdings so abgehalten wird, dass vor allem passive Kenntnisse erworben werden, die zudem nicht immer den kontemporären Standards ensprechen, wird die deutsche Sprache in den nachwachsenden Generationen unter Umständen einen Niedergang erfahren, wie er in einigen Kolonien bereits erkennbar ist.
Ansätze zur Belebung der deutschen Sprache bei Hutterern in Manitoba
Einige Kolonien haben erkannt, dass eine solche Situation langfristig zu einem Verlust der deutschen Sprache führen könnte, was prekäre Folgen für das symbolische Gefüge der Gemeinschaft insgesamt, wie es bisher existiert, hätte. Insbesondere die Kolonien der Schmiedeleit in Manitoba sind aus diesem Grund seit Jahrzehnten bemüht, das Hochdeutsch als Sprache innerhalb der Kolonien voran zu bringen. Hier werden progessive deutsche Lehrwerke und moderne Techniken, wie das Tele-Teaching, über Funkkontakt eingesetzt. So nimmt z.B. Dora Maendel, eine der wenigen zertifizierten hutterischen Lehrerinnen, auf der Fairholme Kolonie mehrmals pro Woche, über Fernsehkamera und Funk, Kontakt zu zahlreichen Schülern in verschiedenen Kolonien der Umgebung auf. Und dieses Projekt soll erweitert werden, damit noch mehr Kolonien auf diese Art vernetzt werden.
In diesen Kolonien wird auch der kulturelle und akademische Wert der deutschen Sprache (zusätzlich zu den religiösen Funktionen) stark gemacht. Der Deutschlehrer der Baker Kolonie, Jonathan Maendel, hat die Beobachtung gemacht, dass das Erlernen und Beherrschen der deutschen Sprache junge Hutterer mit einem neuen Selbstbewußtsein und einer grundsätzlichen Offenheit ausstattet. Dies gilt insbesondere für ihre Fähigkeiten, mit anderen Menschen, seien es andere Hutterer oder Menschen, die nicht der Gemeinschaft der Hutterer angehören, in Kontakt zu treten und damit handlungsfähig zu sein.
In dem Bestreben, das Hochdeutsche als Kommunikationssprache zu fördern, werden die Hutterer dieser progressiven Kolonien von verschiedenen Institutionen unterstützt. So sind zum Beispiel Hutterer seit 30 Jahren Mitglieder der Manitoba Association of Teachers of German. Dies führte dazu, dass heute ein deutscher Fachberater aus Alberta zwei bis dreimal im Jahr zu den Kolonien fährt, um dort jeweils 30-50 hutterische Deutschlehrer in Methodik und Didaktik zu unterrichten, die auf den Kolonien tätig sind. Dies ist insbesondere für die Lehrer in Kolonien wichtig, die keine staatliche Ausbildung haben, denn nicht alle zukünftigen Lehrer absolvieren ein Pädagogikstudium an der Brandon University, die ein besonderes Programm zur Förderung der Ausbildung der Hutterer (BUHEP) eingerichtet hat.
Da sich in den letzten Jahren in verschiedenen Kolonien ein Bewusstsein für das sich zu verbessernde deutsche Sprachniveau breitmachte, wuchs das Interesse an der deutschen Sprache und dem grammatikalisch richtigen Umgang mit ihr. Im Sommer 2004 wurde deswegen vom Goethe-Institut Toronto ein zweiwöchiger Sprach- und Grammatikkurs in der Baker-Kolonie angeboten, nachdem im vergangenen Jahr eine nur dreitägige derartige Veranstaltung auf sehr große Resonanz gestoßen war.
Dass Bemühungen dieser Art erfolgreich sind, zeigt sich daran, dass junge Hutterer aus den progressiven Kolonien der Schmiedeleit aus Manitoba seit Jahren immer wieder Stipendien und Preise gewinnen, die mit einem Intensivsprachkurs in Deutschland (gestiftet vom Goethe-Institut) belohnt werden. Dort lernen sie mit Menschen aus aller Welt gemeinsam die deutsche Sprache und bekommen auch methodische und didaktische Anregungen für die Gestaltung ihres eigenen Deutschunterrichts in den Kolonien. Durch das Kulturprogramm des Goethe-Institutes bekommen sie außerdem einen Einblick in die Kultur und Lebenswelt des heutigen Deutschlands.
Wie auch die eingangs zitierte Evelyn Maendel beschreibt Linda Maendel, die im Sommer 2003 nach Berlin fuhr, ihre Reise als Traum, der Wirklichkeit wurde. Die Fahrt nach Europa ist auch eine Fahrt in die eigene Geschichte, denn hier in Deutschland und Österreich können nun endlich einmal die Orte besucht werden, von denen in den Schriften der Hutterer so viel erzählt wird. Linda aus der Elm River Kolonie schreibt in einem Abschlussbericht: In der Kärntengegend sprechen die Leute unseren Dialekt und es ist wunderbar! Helga bereitet uns ein schmackhaftes Abendessen, das sie „Kudel-Mudel-Nudel“ nennt. Als wir es essen, finden wir, dass es Schuttnkrapfen sind! (...) Am nächsten Tag wollen wir als Erstes das Goldene Dachl sehen. (...) Als wir da stehen und die Gedenktafel lesen, überkommt mich ein Gefühl von tiefster Dankbarkeit. Nachdem wir nun einen ganzen Monat lang, fast jeden Tag, erklären mussten, wer wir sind und woran wir glauben, ist es wirklich einmalig beeindruckend, an genau demselben Ort zu stehen, wo unser lieber Jakob Hutter, seines Glaubens wegen, hingerichtet wurde.
Diese Ansätze, die in einigen der Hutterer-Kolonien bereits seit vielen Jahren existieren und in vielfältiger Art und Weise vom Goethe-Institut und anderen Institutionen unterstützt werden, tragen erheblich dazu bei, den interkulturellen und interreligiösen Dialog auf der Basis einer gemeinsamen Sprache, eines gemeinsamen Verständnisses und einer gemeinsamen Teilgeschichte, für alle Beteiligten im heutigen Kanada entscheidend voran zu treiben.
QUELLEN
Brednich, Rolf W.: Die
Hutterer.
Eine alternative Kultur in
der modernen Welt. Freiburg, 1998.
Hofer, Samuel: The Hutterites. Lives and Images of a Communual People. Saskatoon, 1998.
Holzach, Michael: Das vergessene Volk. Ein Jahr bei den deutschen Hutterern in Kanada. Hamburg, 1980.
Hostetter, John: Hutterite Society. Baltimore, 1974.
Kraybill, Donald B. und Bowam, Carl F.: On the Backroad to Heaven. Old Order Hutterites, Mennonites, Amish, and Brethren. Baltimore, 2001.
Kabarett Weimar: L’intégration d’un thème culturel dans l’enseignement de l’allemand
Nathalie Lachance, Montréal
Le texte qui suit est la version écrite d’une présentation faite lors du congrès de l’ACFAS (Montréal, mai 2004) par Myriam Augustin, Geneviève Dubé et Nathalie Lachance, étudiantes en maîtrise en études allemandes à l’Université McGill.
1. Le projet Kabarett Weimar est né de la volonté d’ajouter une dimension culturelle à un cours d’allemand pour débutants de niveau universitaire; la méthode utilisée en classe, “Deutsch Heute,” est axée sur la communication et l’acquisition de notions traditionnelles (écouter, parler, lire, écrire). Ce texte a pour but de présenter les résultats de ce projet.
Introduit par Myriam Augustin, Geneviève Dubé, Nathalie Lachance et Alexandra Antonakaki dans leurs classes respectives, au cours de dernières semaines de l’année universitaire, ce projet comportait trois volets : un volet didactique plus traditionnel, c’estàdire des minicours magistraux de l’enseignante sur les conditions politiques, sociales et culturelles de la période en question et à l’étude ainsi que des textes de chansons de cabaret ; un volet créatif dans le cadre duquel les étudiants devaient écrire des textes de fiction s’inspirant d’illustrations de l’époque ou des minirecherches sur des personnes clés du monde du cabaret ou de la période en question ; finalement un volet artistique, c’estàdire une présentation de chansons de cabaret, de poèmes ou de compositions personnelles devant un public d’étudiants, de professeurs et d’amis du département d’allemand à l’Université McGill.
Les objectifs du projet étaient de permettre aux étudiants d’approfondir leurs connaissances de base (compréhension et communication orales et écrites), mais surtout de leur offrir la chance de s’approprier la langue allemande de manière plus personnelle, parce que plus créative, ainsi que de se plonger dans un univers culturel fascinant, qui ne manquerait pas de les intéresser, et de les inciter à poursuivre leur études de la langue et de la culture allemandes.
2. Le projet débuta par un volet didactique plus traditionnel ; avant de plonger dans le monde du cabaret, il fallait contextualiser le tout. Chaque enseignante a donc écrit un texte de vulgarisation en allemand simple, chaque texte se concentrant sur un aspect différent du thème.
Le premier texte présentait la République de Weimar en expliquant brièvement les événements historiques qui menèrent à sa création. Ce texte s’attardait aux problèmes des réparations, de l’inflation, de la montée des partis d’extrême gauche et d’extrême droite, de la crise économique, problèmes qui menèrent à la prise de pouvoir par les Nazis en 1933. Les étudiants connaissaient plutôt bien les douze années de régime hitlérien, mais ne savaient pas ou comprenaient peu ce qui avait précédé ces années de règne fasciste. D’après leurs commentaires, ce texte fut fort informatif pour eux.
Le deuxième texte présenta, à l’aide d’illustrations, les différents mouvements artistiques de l’époque : l’expressionisme, le dadaïsme et la Neue Sachlichkeit. Pour contextualiser ces mouvements, il fallut parler non seulement de la modernisation rapide de l’Allemagne de l’époque, en particulier de la métropole Berlin, mais aussi du rôle important de l’émancipation des femmes au sein de cette nouvelle modernité.
Le troisième texte entrait dans le vif du sujet, le cabaret, en retraçant l’origine de ce genre, c’estàdire ses ancêtres parisiens, et en insistant sur son contenu social et politique. Dans les textes des chansons à l’étude, comme “Münchhausen” ou “Wenn die beste Freundin,” les étudiants retrouvèrent les problèmes abordés dans les deux premiers textes ; l’étude des chansons fut donc plus qu’un exercice de compréhension de texte, ce fut un véritable exercice d’analyse littéraire.
Le dernier texte avait pour but de donner aux étudiants un exemple concret de l’art cinématographique et musical de l’époque. Quelques extraits du film “Der blaue Engel” furent visionnés en classe et l’une des chansons du film,“Ich bin die fesche Lola,” fut aussi à l’étude.
Il fallut, évidemment, offrir aux étudiants un glossaire pour chaque texte et éviter certains temps de verbe pas encore vus en classe, comme par exemple le passif. Des questions accompagnaient les textes : elles allaient de “Quelles furent les conséquences politiques de la crise économique en Allemagne?” à l’identification d’artistes aux mouvements artistiques qu’ils représentaient. Les étudiants ont dit avoir trouvé les textes et les questions difficiles – ce qui nous inquiéta quant à la validité du projet. Les étudiants obtinrent par contre d’excellents résultats à ces exercices, ce qui indique que le tout n’était pas si difficile, mais demandait peutêtre un effort inhabituel pour un cours de langue de niveau débutant. Un autre aspect qui occasionna aussi des doutes fut le fait que les discussions des textes en classe ne se firent que difficilement en allemand, ce qui était à prévoir : comment improviser sur de tels thèmes quand on n’apprend l’allemand que depuis quelques mois? Cela peut donc sembler contreproductif, mais en général, nous considérons que ce volet didactique traditionnel fut positif pour la raison suivante : il permit d’élever la discussion en classe à un niveau plus stimulant, intellectuellement, pour des étudiants qui, en tant que jeunes adultes, ont déjà des connaissances en histoire, en politique ou en art. Grâce à ce projet, les étudiants ont pu faire le pont entre ces connaissances et leur apprentissage de l’allemand, se sentant ainsi stimulés et valorisés, et par conséquent plus intéressés.
3. Le deuxième volet du projet faisait appel à la créativité des étudiants. La réussite du cours d’allemand pour débutants à l’université McGill comprend, entre autres, la rédaction de quelques compositions. Le thème Kabarett Weimar s’imposa naturellement aux deux dernières compositions de l’année universitaire. En ce sens, la présentation de Sophie Boyer, “Kunst im DaFUnterricht anhand von Käthe Kollwitz,”lors de la conférence de l’APAQ au GoetheInstitut en février 2003 nous inspira dans l’application concrète de ce projet.
Pour la première de ces deux compositions, quatre illustrations furent proposées aux étudiants : une photo de la fameuse Friedrichstrasse à Berlin vers 1929, “Das Proletariat” de Hans Baluschek (1920) ainsi que “Hunger” et “Soirée” de Georg Grosz (1922).Toutefois, les titres et les noms des artistes ne furent pas dévoilés aux étudiants. A partir de l’image de leur choix, les auteurs en herbe devaient, soit inventer une petite histoire (qui sont ces gens? que fontils? d’où viennentils? etc.), soit simplement décrire la scène observée. Les étudiants ont adoré cet exercice dans le cadre duquel ils purent laisser libre cours à leur imagination.
Pour la deuxième de ces compositions, les étudiants devaient faire une minirecherche sur un sujet se rapportant au monde du cabaret ou de la République de Weimar. On put lire des textes sur Max Beckmann, Rosa Luxemburg, Marlene Dietrich, Lion Feuchtwanger, ainsi que sur le mouvement expressionniste ou l’émancipation des femmes. Certains analysèrent des textes de chansons ou résumèrent “L’Opéra de Quat’Sous” de Brecht. Une étudiante poussa même l’originalité jusqu’à écrire le journal intime d’un travailleur subissant les contrecoups de l’inflation.
Ces compositions, comme toutes les précédentes, devaient inclure certains éléments grammaticaux tels que des adjectifs, constructions infinitives, prépositions, etc. La longueur du texte de la quatrième composition variait toutefois selon le degré d’implication de l’étudiant dans le volet artistique de notre projet. Ainsi, les plus timides, ceux qui ne voulaient ni chanter ni réciter en public, devaient écrire 200 mots, alors que nous n’exigions qu’un texte de 120 mots de ceux et celles qui voulaient présenter un numéro lors de notre soirée cabaret.
Les résultats des compositions ne furent ni meilleurs ni pires que les résultats des compositions précédentes, mais l’aspect créatif de ce volet enchanta littéralement les étudiants : ce volet, tout comme le volet didactique, fut donc un succès en ce qu’il inspira aux étudiants un intérêt accru pour le cours d’allemand grâce à cette implication plus personnelle, car plus créative.
4. Le volet artistique du projet consistait en une soirée cabaret, en fait un “5 à 7,” en présence d’étudiants, de professeurs et d’amis du département d’allemand à l’université McGill. Nous en profitons ici pour remercier Dr. Karin Bauer, directrice de notre département, grâce à qui nous avons pu offrir un léger buffet aux participants et invités.
Tel que mentionné, les étudiants qui devaitent écrire uniquement 120 mots lors de la dernière composition de l’année universitaire devaient, en contrepartie, présenter un numéro lors de cet événement. Peu d’étudiants voulurent relever le défi, mais les numéros présentés totalisèrent tout de même un spectacle d’environ 60 minutes. En voici quelques exemples : une étudiante en musique chanta magnifiquement “Ich bin vom Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt,” avec costume, coiffure et maquillage typiques du style cabaret ; un étudiant en philosophie déclama avec brio “Fantasie von übermorgen” d’Erich Kästner ; un autre étudiant en musique y alla d’une interprétation délirante de la chanson de Brecht et Weill “Die Ballade von der sexuellen Hörigkeit”, alors qu’une de ses collègues nous raconta comment “Die Dreigroschenoper” était né. D’autres chansons et poèmes complétèrent la soirée, qui fut fort appréciée de tous.
Si cette soirée était à refaire, il faudrait cependant penser à des stratégies concrètes pour mieux la promouvoir, non seulement auprès des étudiants appelés à présenter un numéro mais aussi auprès des étudiants devant former le public, le petit nombre d’étudiants ayant assisté à la soirée (environ 20 % des débutants) étant plutôt décevant. Une manière concrète d’améliorer cet aspect serait peutêtre de demander aux étudiants formant le public d’écrire, en classe, le lendemain, une courte critique de l’événement (qui compterait, bien sûr, pour des points).
5. En résumé, la méthodologie utilisée dans le cadre de ce projet donna des résultats encourageants: s’attaquer à un thème tel que le cabaret et la République de Weimar est exigeant, mais stimulant. Les discussions en classe autour du thème permirent aux étudiants de faire le pont entre leurs connaissances personnelles et leur apprentissage de l’allemand, ce qui entraîna un intérêt accru pour le cours. Les compositions, textes de fiction et minirecherches, furent l’aspect du projet le plus apprécié des étudiants, les résultats de cette approche créative n’étant, par contre, du point de vue de l’apprentissage de la langue, ni meilleurs ni pires que les approches moins créatives précédemment utilisées. Il manquait au volet artistique des stratégies concrètes pour s’assurer de la participation de tous les étudiants.
Le projet Kabarett Weimar a donc atteint son objectif de permettre aux étudiants de s’approprier la langue allemande de façon plus personnelle et plus créative, ce qui ne peut que les inciter, nous le croyons, à poursuivre leurs études de la langue et de la culture allemandes.
Was heißt hier Pop? Zur Inszenierung der Popliteratur [1]
Konstanze Kendel, Wolfville
Im Literaturbetrieb der Gegenwart lassen sich allgemeine Tendenzen ausmachen. Unter zunehmendem ökonomischem Druck scheint das Buch zur Ware zu werden, die vermarktet werden muss. Dies gilt auch für die Person des Autors, für die ein zunehmendes Interesse des Publikums auszumachen ist. Sie wird mehr und mehr zur medial gehandelten Marke. Um ein möglichst breites Publikum zu erreichen, sind die Autoren in der veränderten Medienlandschaft gezwungen, in derselben als Person präsent zu sein. Die werbewirksame mediale Aufmerksamkeit ist von wachsender Bedeutung und wird mit unterschiedlichen Mitteln erkämpft. Der Kampf um die Definitions- und Repräsentationsmacht scheint innerhalb des Literaturbetriebes besonders entbrannt in der Diskussion über die Popliteratur und deren Vertreter. Die Entwicklung hin zu zunehmender Selbstinszenierung und der Trend zum Event werden unter dem Label "Popliteratur" selbstbewusst vertreten.
Ursprünge der Popliteratur
„Doch irgendwann sind sie dran, und dann kennt sie keiner mehr, gestern niemand, morgen tot und dazwischen was? Populär! Pop pop pop populär!“ [2] lautet ein Refraintext der Hip Hop Gruppe ‚Die Fantastischen Vier’. Diese Textzeile verweist darauf, dass das eigenständige Lexem ‚Pop’ zurückzuführen ist auf den Begriff ‚populär’. Populär bedeutet ursprünglich zunächst zweierlei: dass etwas zum einen allgemein bekannt, beliebt, mit anderen Worten breitenwirksam und zum anderen allgemeinverständlich ist. [3] In diesem Begriff vereint sich also die ästhetische Kategorie (für viele zu verstehen) mit der ökonomischen Kategorie (hohe Verkaufszahlen). Kulturtheoretisch verwendet stammt der Begriff aus dem Kontext der englischen Geistes und Sozialwissenschaften. Die ‚popular culture’ gilt in diesem Zusammenhang seit Ende des 19. Jh. als Gegenstück zur elitären oder Hochkultur. [4]
Während sich die populäre Literatur dadurch auszeichnet, dass sie vorrangig darauf angelegt ist, möglichst hohe Verkaufszahlen zu erzielen, hat sich die Popliteratur aus einem post- oder auch popmodernen Zeitgeist entwickelt. Die Ursprünge der Popbewegung, die in den 60er Jahren des 20.Jh., ausgehend von der bildenden Kunst auch andere Kunst- und Lebensbereiche beeinflusst hat, entwickelten sich in den USA als Protestbewegung gegen die etablierte Opposition von Massen- zur Hochkultur. In den 60er Jahren forderte Fiedler in seinem Aufsatz mit dem Originaltitel „Cross the border, close the gap“ (1968) die Überquerung des Grabens zwischen elitärer und Unterhaltungsliteratur durch eine allgemeinverständliche, inhaltlich wie formal am breiten Publikum orientierte Literatur. Die Wortneuschöpfung "Popliteratur" entstand aus einem Spiel mit den Begriffen ‚popular culture’ und ‚Pop-Art’. „Anspielend auf ‚Pop’ als Derivat von ‚populär’ sowie lautmalerisch auf das dem englischen entstammende ‚to pop’ (knallen, platzen) verschmilzt hier die rebellisch-subversive Dimension der antibürgerlichen Gegenkultur der US-amerikanischen popular culture mit dem explosiv revolutionierenden Gestus einer gegen den Status Quo auftrumpfenden Generation.“ [5]
In der Ära der Beatles und Rolling Stones wurde vor allem Westdeutschland von der US-amerikanischen Populärkultur, der Beatmusik und der Pop-Art beeinflusst. Die thematische Auseinandersetzung mit Sex, Drogen und Musik sowie die ästhetischen Neuerungen beeinflussen die Popliteratur bis heute. Das Aufbegehren gegen Konsum, Kommerz und Manipulation ging allerdings in der Folgezeit mehr und mehr verloren. [6] Anfang der 70er Jahre ließ die „Tendenzwende“ hin zur Neuen Subjektivität und die damit einhergehende Etablierung von Autoren wie beispielsweise Peter Handke, Hubert Fichte und anderen das Interesse an dem Phänomen Popliteratur schwinden. [7]
Rainald Goetz, Andreas Neumeister und Thomas Meinecke verkörperten Ende der 80er Jahre dann zunächst eine neue Generation von Popautoren. Sie traten als Autoren, Musiker und DJs auf und befassten sich in ihren Texten mit dem so genannten Lifestyle der Jugend, sowie mit Theorien der Postmoderne. Verlegt wurden sie beim Suhrkamp Verlag, der als Vertreter hochkultureller Literatur galt.
In den 90er Jahren gelangte eine neue Form der Popliteratur ins Rampenlicht des Literaturbetriebes. Sie war nicht mehr subversiv, sondern Teil der Kulturindustrie. Ein Großteil dessen, was die Popkultur ausmachte, war ‚Mainstream’ geworden. Auch die bürgerlichen Feuilletons nahmen die Impulse auf und etablierten den Popjournalismus. [8] Neue Leser und im speziellen die Jugend sollten durch die Pop-Projekte großer Zeitungen, wie der Frankfurter Allgemeinen und der Süddeutschen Zeitung, angesprochen werden. Diese Form des ‚leichten’, ironischen, oberflächlichen Lifestyle-Journalismus war durchaus umstritten. Popliteraten wie Stuckrad-Barre, Florian Illies und auch der junge Benjamin Lebert schrieben für die Lifstylemagazin-Beilagen, die mittlerweile aufgrund ausbleibenden Erfolgs- und Geldmangels größtenteils eingestellt wurden. Das Publikum verlor nach und nach das Interesse an den beschriebenen Oberflächlichkeiten und auch das Prinzip, Alltägliches zum Kult zu erheben, verlor seinen Reiz. Das Label ‚Pop’ erwies sich dennoch als verkaufsförderndes Markenzeichen, was in krassem Gegensatz zur ursprünglichen Intention stand, eine Subkultur zu schaffen, die nicht von der Kulturindustrie zu vereinnahmen sei.
Popliteratur heute – Versuch einer Definition
Den Boom der neuen Popliteratur eröffnete, in Anlehnung an Bret Easton Ellis’ American Psycho, 1995 Christian Krachts Faserland, gefolgt von Alexa Henning von Langes Drogen-Wochenend-Roman Relax. Benjamin von Stuckrad-Barre veröffentlichte in kurzen Abständen sein Soloalbum (1998) nach dem Vorbild von Nick Hornbys High Fidelity, Live album (1999) und Remix (1999). Im gleichen Jahr erschienen das von Joachim Bessing herausgegebene Tristesse Royale. Das Popkulturelle Quintett (1999) sowie die von Christian Kracht herausgegebene Sammlung zahlreicher Kurzgeschichten junger deutscher Autoren, Mesopotamia, Ernste Geschichten am Ende des Jahrtausends (1999). Jüngster und gleichzeitig größter Erfolg ist das Buch Crazy (1999) des damals 17-jährigen Benjamin Lebert. Florian Illies veröffentlichte ein Buch über die Generation Golf, Eine Inspektion (2000), das neben Tristesse Royal auch eine Art Manifest der eigenen Generation darstellt. Aufgrund der verschiedenen Autoren, deren mannigfachen Schreibstile und der keineswegs identischen Kontexte, bleibt eine solche Beschreibung zwangsläufig bis zu einem gewissen Grad vage und verallgemeinernd. Gleichwohl gibt es wiederkehrende Themen sowie ähnliche Schreibstile und Gemeinsamkeiten in Auftreten und Aussagen von Autoren, die es erlauben, repräsentative Einheiten zu bilden und diese zu benennen.
Der Ursprung der jüngsten Popliteratur ist zwar in den 60er Jahren zu finden, ihr Erscheinungsbild hat sich jedoch in einigen Punkten grundlegend geändert. Popliteratur ist nicht mehr das Ausdrucksmittel einer Subkultur, sondern wird öffentlichkeitswirksam von Autoren verfasst, die als Trend, Kult- oder Lifestyleautoren bezeichnet werden können. [9] Die allgemeinen Merkmale bzw. der Inhalt der Popliteratur stehen in Zusammenhang mit der Form, in der sie präsentiert werden. Die Inszenierungsweise ist nicht zu trennen vom Inhalt des Textes.
Themen der Popliteratur
Thematisch orientiert sich die Popliteratur, wie bereits in ihrer frühen Form, an den Themen der Populärkultur. Erzählt wird von Erlebnissen des Einzelnen in der Wohlstandswelt. Die Erlebnisse transportieren ein Lebensgefühl, handeln schwerpunktmäßig von Erfahrungen wie Einsamkeit, Entfremdung, Sexualität, Gewalt und Verlust einer Partnerschaft. Eine bedeutende Rolle wird auch dem Musikkonsum, den Massenmedien, dem Aufenthalt in Clubs, auf Partys usw. sowie dem Drogenkonsum zugeschrieben. Das Subjekt der Erzählung (ausnahmslos Ich-Erzähler) ist oftmals gelangweilt, äußert sich zynisch, trifft Werturteile über das Verhalten und die Kleidung anderer und erscheint orientierungslos. [10] Die Wahrnehmung und fast ausschließlich realistische Darstellung von Wirklichkeit bzw. der subjektiven Wirklichkeit des Erzählers beschäftigt sich in der Regel nicht kritisch mit überindividuellen, sozialen oder politischen Zusammenhängen. Diese Form der Darstellung von Alltagserfahrungen beinhaltet, dass kein Anspruch auf Dauerhaftigkeit erhoben wird. Es geht um das Hier und Jetzt.
Ästhetisch stilistische Charakteristika
Die Sprache der Popliteratur wendet sich gegen hochliterarische Sprachstandards. Geschrieben wird teils in einer Szene- oder Gangsprache bis hin zur Alltags- und Mediensprache. Häufig werden Anglizismen, Namen von Bands oder Songtiteln sowie Lyrics, Produkt und Markennamen, Filmtitel und Reklameslogans verwendet. Auffällig sind auch Spontaneität und Sprachwitz. Neben der umgangssprachlich gehaltenen Sprache sind auch die Strukturen schlicht. Die Kapitel sind kurz, die Figuren meist stereotyp beschrieben. Die DJ-Autoren mixen und sampeln die Erfahrungen mit VIVA, MTV und der Konsumwelt um sie herum. [11] Die Erfahrungen des Ich-Erzählers sind oftmals angelehnt an die Erfahrungen des Autors, wie beispielsweise in Benjamin Leberts Crazy oder in Stuckrad-Barres Livealbum. „Sie schreiben, so scheint es, am liebsten über sich selbst.“ Auf diese Aussage antwortete Benjamin von Stuckrad-Barre in einem Zeit-Interview mit den Worten „Entschuldigung, aber über wen denn bitte sonst?“ [12] Die Technik des Mixens und Sampelns verweist auf einen erweiterten Textbegriff, der auch durch das Layout sowie Text-Musik oder Text-Sound-Ensembles deutlich wird.
Was heißt hier Pop?
Wer nun tatsächlich ein Popliterat ist, und wessen Texte als Popliteratur zu bezeichnen sind, bleibt umstritten. Thomas Jung schränkt den Kreis der Popliteraten ein, indem er zunächst eine westdeutsche Sozialisation voraussetzt und den Kern durch die Herren des selbsternannten ‚popkulturellen Quintetts’ vertreten sieht, zu denen aber zusätzlich weibliche Vertreterinnen wie Alexa Henning von Lange und Sibylle Berg zu zählen sind. [13] Auch Benjamin Lebert wird des Öfteren als Popliterat bezeichnet. Hinzu kommen Autoren mit Migrationshintergrund, wie beispielsweise Feridun Zaimoglu und Wladimir Kaminer, sowie ostdeutsche Autoren wie Thomas Brussig. Auch die Autoren Thomas Meinecke, Rainald Goetz und Andreas Neumeister zählen nach wie vor zur Gruppe der Popliteraten, auch wenn ihr Geburtsdatum weiter zurückliegt.
Obgleich die Jugendlichkeit der Verfasser augenscheinlich ein entscheidendes Merkmal der Popliteratur ist, so ist es doch vielmehr ein Lebensgefühl, ein Stil und die Beschäftigung mit oben genannten Themen als ein zu benennendes Alter, was die Popliteraten verbindet. Die Autoren selbst wollen sich allerdings nicht unter einem Label vermarkten lassen, das ihrer Ansicht nach nicht aussagekräftig, zu undefinierbar ist und womöglich von Kritikern zur Bescheinigung mangelnder Qualität gebraucht wird. Pop ist auch die Inszenierungs- und Promotionsform, sowie die Gestaltung der Produkte, das Format, sowie das Selbstverständnis des Autors.
Inszenierungsformen
Der Autor hat durch die veränderte Medienlandschaft zunehmend seine Person zu präsentieren. Dies tut er bei Live-Auftritten, im Radio, in Zeitschriften, im Fernsehen oder auch im Internet. Die Popliteraten nutzen diese Medien, besser gesagt: Diese Nutzung ist Teil des Phänomens Pop. Das Publikum besteht zwar noch immer zu einem Großteil aus Lesern, bekannt sind die Popliteraten jedoch auch den Zuschauern, den Zuhörern und manchen, die möglicherweise nicht mehr nachvollziehen können, in welchem Zusammenhang sie ihnen begegnet sind. Die Massenmedien ermöglichen, transportieren und basteln am Image des Schriftstellers. Die Popliteratur hat sich dem massenmedialen Spektakel jedoch nicht nur gewissermaßen angepasst, sondern sie ist durch die Sozialisation ihrer Vertreter sowie durch den Einfluss des Fernsehens auf die Erzählweise eng mit diesem verbunden. Neben der medialen Inszenierung gehört die assoziative Verbindung eines Autors mit der Popwelt zu dem, was den Popliteraten ausmacht. Die Autoren werden nach dem Muster von Popstars aufgebaut. Sie haben ein bestimmtes Styling, ein Outfit – eben ein bestimmtes Image. Dieses soll Schlagfertigkeit, Szenennähe und vor allem Jugendlichkeit vermitteln. Da das gekonnte Auftreten, die Sprachgewandtheit und eben die Jugend von den Medien als erstrebenswerteste Werte dargestellt werden, sprechen die Popliteraten ein Publikum an, das sich mit diesen Werten und somit bis zu einem gewissen Grad mit der Person des Autors identifiziert. Zwar war das äußere Erscheinungsbild und das Auftreten schon immer von Bedeutung, jedoch scheint eine Verschiebung des Verhältnisses zwischen Autor und Text beobachtbar. Die Inszenierung ist oftmals Teil des Textes. Dies wird exemplarisch an dem von Joachim Bessing herausgegebenen Tristesse Royal deutlich.
Das selbsternannte popkulturelle Quintett, bestehend aus Joachim Bessing, Christian Kracht, Eckhart Nickel, Benjamin von Stuckrad-Barre und Alexander von Schönburg, fand sich 1999 im Hotel Adlon zusammen, um den Zustand ihrer Generation zu besprechen und dieses Gespräch aufzuzeichnen. Die Idee für den Gesprächsband lieferte Joachim Bessing, der von seinem Verlag gebeten wurde, ein Buch für eine junge Leserschaft zu verfassen. „Es ist ein solcher Irrsinn, was die Leute in meinem Alter heutzutage beschäftigt, dass ich dachte, es könnte höchst unterhaltsam sein, ein typisches Gespräch unserer Zeit einmal abzubilden. Unterhaltsam und traurig.“ [14] Im Gespräch über Deutschland, Moden, Politik und Trends sollte folglich ein Sittenbild ihrer Generation entworfen werden. Der Gesprächsband sollte als eine Art Spiegel – eine Reflexion der Oberfläche – fungieren. Auf dem Buchrücken ein Zitat aus dem Tagesspiegel: „Zehn Jahre nach 1989 formiert sich in Deutschland eine neue Generation – ihr Manifest heißt Tristesse Royale.“ Unter diesem Titel veröffentlichte Joachim Bessing die von ihm transkribierten und redaktionell überarbeiteten Tonbandmitschnitte. Die jungen Autoren inszenierten den Wohlstand und die Verblendung, der sie sich ausgeliefert fühlen.
Alexander von Schönburg: Wir werden von vorne bis hinten entertained. Die Spannung ist weg. Das geht sogar so weit, dass sich völlig gesunde und vernünftige Menschen, wie wir es sind, für Geld im Adlon einsperren lassen, um über unsere Wohlstandsverwahrlosung zu lamentieren. Wäre das hier Cambridge und nicht Berlin, und wäre es jetzt der Herbst des Jahres 1914 und nicht der Frühling des Jahres 1999, wären wir die ersten, die sich freiwillig meldeten. [15]
Mit dem Begriff „wohlstandsverwahrlost“ bezeichnet Alexander von Schönburg ein Problem der so genannten 89er Generation, die sich nach eigener Aussage in einem „Zustand der industriellen Vollverspaßung“ [16] befindet. Der Wunsch, erlöst zu werden, erscheint zunächst absurd. Die Langeweile, der Reichtum, die neokonservative Haltung, kurz eben die Wohlstandsverwahrlosung wurde von der Herrenrunde nicht bloß thematisiert, sondern eben geradezu theatralisch zur Schau gestellt. So wurde, mit teuersten Anzügen bekleidet und Zigarre rauchend, über teure Kleidung, die Bedeutung der Marken und Statussymbole gesprochen, während man sich in den Luxussuiten eines Nobelhotels aufhielt.
Alexander von Schönburg: Die Langeweile ist der Hauptfeind unserer Generation, weil wir damit aufgewachsen sind, verwöhnt und von Reizen überflutet. Wir sehnen uns nach der Unterbrechung der Langeweile. Wer an Hunger leidet und nicht im Adlon sitzt, langweilt sich nicht. Wir sind nichts als Produkte einer postmateriellen Generation, die nur noch mit der Langeweile zu kämpfen haben. [17]
Auch die Lesungen der Popliteraten, wie alle öffentlichen Auftritte, dienen der Selbstinszenierung, der Festigung des Images. Dabei ist das Phänomen der Inszenierung einer Lesung keineswegs neu. Der Raum, die Accessoires, die beabsichtigte Atmosphäre wurde seit jeher inszeniert, dem Image des jeweiligen Autors angepasst bzw. gewählt, um dieses zu unterstreichen. Die Inszenierung der Pop-Lesung hat jedoch eine neue Qualität. In Anlehnung an die Inszenierung der Stars des Popgeschäfts arbeiten die Techniker mit verschiedensten Licht- und Soundeffekten, um den Popliteraten einem Popstar entsprechend zu präsentieren. Darüber hinaus scheint der Text als solcher nicht mehr genug, und es werden eine Reihe von Überschreitungs- und Entgrenzungsformen gewählt, um das Publikum zu unterhalten und den Text zu vervollständigen. Es geht also nicht einzig und allein um den Effekt. Die gewählten Songeinspielungen beispielsweise sind auch inhaltlich von Bedeutung.
Auffälliges Element der Inszenierung ist der starke Publikumsbezug, der die Spontaneität und Nähe zu den ‚Fans’ unterstreichen soll. Die Theatralisierung der Literatur ist fester Bestandteil des Pop-Phänomens – die Performance ist entscheidend. Die Leser erwarten den Auftritt des Stars, einen unterhaltsamen Abend, ein paar Spitzen, lockere Sprüche und Überraschungen.
Die Popliteratur erzählt nicht von fiktiven Lebensentwürfen, sondern von tatsächlichem, echtem, alltäglichem Leben. Diese Tatsache bringt ihr einerseits die Kritik ein, langweilig zu sein. Eine hohe Auflagenzahl beweist andererseits, dass Interesse an einer solchen Literatur besteht. Wie aber ist dieses Interesse zu erklären? Wen spricht die Inszenierung an und weshalb? Wie ist das große Interesse an Texten und Autoren der Popliteratur zu erklären?
Die Funktion der Inszenierung
Die Sprache und Struktur der Popliteratur, sowie die Inszenierung der Leseperformance, kommen dem Rezipienten entgegen, da sie ihm weder eine hohe Konzentration noch viel Vorstellungskraft abverlangen. Let me entertain you! Diese Prämisse wird offen nach außen getragen und gilt nicht als Zeichen für qualitativ minderwertigen Kulturgenuss. Das Buch an sich verlangt dem Leser im Vergleich zu dem neueren Medium Fernsehen oder dem Internet insofern mehr ab, als dass es linear aufgebaut ist und das Hin- und Herzappen wie im Hypertext nicht oder nur selten möglich ist. Das in der Regel passive und einsame Konsumieren macht das Buch im Vergleich zu anderen Medien zu einem trägen Informationssystem. Dem widerspricht die Leseperformance der Popliteratur. Die Oberflächlichkeit hat Hochkonjunktur, was sich auch im Kulturkonsum der Gesellschaft widerspiegelt. Eine Funktion der Inszenierung ist es also, das Buch spannend zu machen und sich auf dem Markt zu behaupten. Der Popliterat wird inszeniert und inszeniert sich, um zu unterhalten, auf sich aufmerksam zu machen und die Ware Buch, das Produkt bestmöglich zu bewerben. Literatur darf nicht nur unterhalten, sie muss es sogar. Entertainment ist aus der Sicht der Popliteraten selbstverständliche Aufgabe oder besser – Teil des Selbstverständnisses.
Das Buch ist eine Ware, und die gilt es, an den Mann und an die Frau zu bringen. Zu diesem Zweck wird maskiert und entertained. Und doch verweist die Haltung der Popliteraten auf ein weiteres Prinzip, das in der neuen Popliteratur auszumachen ist: das Setzen von Unterschieden in einer Gruppe, gegen alle anderen. Die Unterschiede, die hier deutlich gemacht werden sollen, beruhen nicht auf schwerwiegend gegensätzlichen politischen oder weltanschaulichen Uneinigkeiten. Sie haben vielmehr die Funktion, Statusunterschiede zu markieren. Gemeinsamkeit in Status und Privileg sind geprägt von der Abgrenzung zu dem Anderen und ermöglichen das Wir-Gefühl, um das es letzten Endes geht.
Was für frühere Bildungseliten die Hochkultur war, das ist für die neue Elite die Populärkultur. „Platten,Videos und Stilfragen sind für die Identität der heutigen Neobürger ebenso bedeutungsvoll wie die Hochkultur in vergangenen Tagen.“ [18] Es entsteht eine neue Form der Hochkultur, in der das gekonnte Mixen und Sampeln der pluralistischen und doch individuellen Erfahrungen sowie der souveräne Umgang mit Medien aller Art Zugehörigkeit ausweist. Nicht die Abgrenzung von der Populärkultur definiert den legitimen Geschmack dieser neuen Elite, sondern die kenntnisreiche, teils ironische Einbeziehung desselben, das Wissen über Phänomene der Massenmedien und die nüchterne Betrachtung der eigenen Abhängigkeit und Beeinflussbarkeit. Personen wie Harald Schmidt oder auch Stuckrad-Barre verkörpern einen neuen Typ des anspruchsvollen Unterhalters mit eigenem Sendeformat – eines marken- und medienbewussten Intellektuellen.
Als populär können Sprache und Struktur bezeichnet werden, die der Popliteratur zugrunde liegen. Sie sind allgemeinverständlich und die Vermarktung ist auf ein möglichst breites Publikum angelegt. Populär ist sie jedoch nicht im Sinne einer Allgemeinverständlichkeit des Inhalts. Das Zitieren von Lyrics, Bandnamen, Songtiteln oder Markennamen, um eine Person zu charakterisieren oder ein bestimmtes Gefühl genauer zu definieren, setzt voraus, dass das Publikum die entsprechenden Assoziationen teilt.
Das Interesse an der Nacherzählung des täglichen Wahnsinns deutet auf eine Unsicherheit des Publikums – auf den Wunsch hin, im eigenen Dasein bestätigt zu werden. Die zunehmende mediale Inszenierung aller Lebensbereiche bringt Unsicherheit über das eigene Dasein mit sich. In der konsumorientierten Gesellschaft ist es die Gestalt der Oberfläche, die interessiert. Und genau davon handelt die Popliteratur: Wie sehe ich aus? Wie wirke ich? Von wem grenze ich mich ab? Es geht darum, das Leben durch die Wahl der richtigen Accessoires zu perfektionieren. Die Auseinandersetzung mit Utopien wirkt störend und verunsichert. Die Popliteraten verkörpern dagegen eine „Sicherheit des Lebensstils, Souveränität des Geschmacks und eine beneidenswerte Unabhängigkeit, was Geld betrifft.“ [19] Es scheint gerade das Wiedererkennen des Alltäglichen zu sein, was den Reiz der Popliteratur ausmacht: Das Wiederentdecken des eigenen Lebens zwischen zwei Buchdeckeln. Besonders auffällig wird diese Beobachtung bestätigt durch den Erfolg von Florian Illies’ Generation Golf. Die Feststellung, dass eigene Kindheitserfahrungen Kollektiverfahrungen sind, über die man sich austauschen kann und die mit ähnlichen Gefühlen verbunden werden, scheint die Richtigkeit des eigenen Lebens zu bestätigen. So lässt sich verallgemeinernd sagen: Das Publikum dieser Literatur ist auf der Suche nach dem eigenen Standort in der Welt, nach Zugehörigkeit, nach Identifikation. Diejenigen, die die Fragwürdigkeit der eigenen Lebensentwürfe in den Texten der Popliteraten enttarnt sehen, identifizieren sich mit den Ansichten und Erlebnissen der Ich-Erzähler.
Darüberhinaus ist die allen Generationen eigene Abgrenzung zur vorhergehenden Generation auch in dieser auszumachen. Die hier genannte Vollverspaßung und das damit einhergehende Fehlen von Utopien sowie die unpolitische egoistische Haltung soll die Abgrenzung zur Elterngeneration deutlich machen. Dies findet sich auch in der Popliteratur. Sie setzen den Konsum gegen die Konsumkritik. Die Kritik, die dieser Haltung entgegensteht, ist weniger eine Kritik am Text als eine Kritik der Medien- und Alltagskultur, zu denen den Kritikern der Zugang fehlt. Florian Illies hebt diese Distinktionsfunktion der Popliteratur in seinem Generation Golf lobend hervor: „Die Ernsthaftigkeit, mit der Kracht Markenprodukte einführte und als Fundamente des Lebens Anfang der neunziger Jahre vor Augen führte, wirkte befreiend. Nicht nur ich, so durfte man endlich sagen, finde die Entscheidung zwischen einer grünen und einer blauen Barbour-Jacke schwieriger als die zwischen CDU und SPD. Es wirkte befreiend, dass man endlich den gesamten Bestand an Werten und Worten der 68er-Generation, den man immer als albern empfand, auch öffentlich albern nennen konnte.“ [20] Dabei muss betont werden, dass die Generation Golf nicht gleichzusetzen ist mit der gesamten jüngeren Generation. Illies schreibt über und für die, die sich einen bestimmten Lebensstil leisten können und sich somit zum Zielpublikum der Popliteraten qualifizieren.
Pop in der Ironiefalle
Wenn alles Pop ist, gibt es keinen Pop mehr. Aus Gründen der Distinktion muss sich in dem Moment, in dem Thomas Gottschalk wie auch Angela Merkel irgendwie Pop ist, etwas Neues entwickeln. Der Pop, die totale Affirmation, das uneingeschränkte Ja, das Alltägliches zur Kunst stilisiert, provoziert eine Bewegung hin bzw. zurück zu der Forderung nach konservativen Werten, zu Anti-Konsum und Anti-Pop.
Auch wenn Literatur, die von der Oberfläche handelt, nicht gleichzusetzen ist mit oberflächlicher Literatur, mehren sich innerhalb des Literaturbetriebs doch die Stimmen, die überhaupt eine kritischere Haltung oder eine andere Form der Gesellschaftskritik fordern. „Der Pop macht müde, und die Affirmation läuft leer. Wer immer Ja! sagen muss, beraubt die Literatur ihres trotzigen Nein!, ihres Aber und Andererseits. Wer auf die totale Gegenwart fixiert ist, nimmt sich die Möglichkeit ihrer Erklärung und erklärt sie zur Black Box.“ [21] Dieser Leerlauf der totalen Affirmation langweilt auf Dauer. Das Abbild ist nur bis zu einem gewissen Grad aussagekräftig. Ein Gegenbeispiel wären die provokanten und gesellschaftskritischen Inszenierungen Christoph Schlingensiefs (dessen Name auch auf der Homepage Stuckrad-Barres zu finden ist). Es scheint, als müssten sich die Autoren, die sich als Kritiker der Gegenwart verstehen, von dem Begriff Popliteratur distanzieren.
Es entsteht der Eindruck, dass der Event an sich nicht ausreicht, dass der Aspekt der Unterhaltung auf Dauer nicht der vordergründige bleiben kann. So scheint es, dass die Popliteratur und deren Inszenierung zunächst durch die „Simulation des Bekannten“ [25] Aufmerksamkeit erregt und ein großes junges Publikum angesprochen hat. Das war vorrangig Mitte der 90er Jahre. Heute hat die Euphorie deutlich nachgelassen.
Das Publikum ist in der Zeit des Umbruchs vielschichtig und so sucht die Literatur nach neuen Formen und Ausdrucksmöglichkeiten. Die genauer zu erkundenden Arbeitsfelder, die sich bei der Betrachtung dieser Entwicklung auftun, sind die Internetliteratur, die populäre Migrantenliteratur, der so genannte Antipop, und die Slam Poetry. In der Nachfolge des Pop findet sich Literatur wie die Social-Beat- oder Kanak-Sprak-Literatur. Dabei wird das Verhältnis von Literatur zu Medien mit dem wachsenden Einfluss von Fernsehen und Internet ein wichtiges Thema bleiben oder voraussichtlich noch wichtiger werden.
ANMERKUNGEN
[1] Im Sommer 2004 habe ich meine Examensarbeit an der Universität Bremen unter dem Titel „Let me entertain you! Die Inszenierung der Popliteratur im Literaturbetrieb der Gegenwart“ eingereicht. Der hier vorliegende Aufsatz ist ein Auszug aus dieser Arbeit.
[3] Vgl. Krämer, H./Zimmermann, H.: Brockhaus Wahrig. Deutsches Wörterbuch. Stuttgart 1980.
[4] Vgl. Jung, T. (Hg.): Alles nur Pop? Anmerkungen zur populären und Pop-Literatur seit 1990. Frankfurt/M. 2002, S. 11.
[5] Jung, T.: Vom Pop international zur Tristesse Royale. In: Jung, S. 36.
[6] Vgl. Jung 2002, S. 37.
[7] Vgl. Jung 2002, S. 37.
[8] Das Lifestyle-Magazin ‚Tempo’ der Süddeutschen Zeitung erschien erstmals bereits Mitte der 80er Jahre. Vgl. Ernst 2001, S. 58.
[9] Vgl. Ernst, S. 72 ff.
[10] Vgl. Jung 2002, S. 41. Vgl. auch Ullmaier, J.: Von Acid nach Adlon. Eine Reise durch die deutschsprachige Popliteratur. Mainz 2001, S. 17.
[11] Pop ist also in gewisser Weise Schnittstelle zwischen Ökonomie und Ästhetik, da der Kommerz beabsichtigt ist und häufig thematisiert wird.
[12] Philippi, A./Schmidt, R.: Wir tragen Größe 46. In: Die Zeit online, 37/1999, http://www.zeit.de/archiv/1999/37/199937.reden_stuckrad_k.xml (8.12.2003)
[13] Vgl. Jung 2002, S. 40.
[14] Interview mit Joachim Bessing von Nikolaus Till Stemmer, http://www.proqm.de/Veranstaltungen/tristesse/tristesse.html (28.11.2003).
[15] Bessing, J. (Hrsg.): Tristesse Royale. Das popkulturelle Quintett mit Joachim Bessing, Christian Kracht, Eckhart Nickel, Alexander v. Schönburg und Benjamin v. Stuckrad-Barre. Berlin 1999, S. 138.
[16] http://www.bundestag.de/cgibin/druck.pl?N=parlament (28.11.2003).
[17] Bessing, S. 33.
[19] Vgl. Bernhard, T.: Alles Pop? In: Süddeutsche Zeitung, 6.4.2000.
[20] Illies, F.: Generation Golf. Berlin 2000, S. 155.
[21] Wieland Freund: Die Welt, Pop, Papa? 24.3.2001.
[22] Jung, T.: Viel Lärm um nichts? Beobachtungen zur jüngsten Literatur und dem Literaturbetrieb. In: Jung 2002, S. 12.
Trotz sprachlicher Schranken im Dialog. Künstleraustausch zwischen Quebec und Bayern
Jürgen Heizmann, Montreal
Seit 1989 besteht die internationale Kooperation zwischen Quebec und Bayern – ohne Absegnung Ottawas. Die beiden Regionen, die im Kampf für die Eigenständigkeit und die Wahrung ihrer kulturellen Identität manches gemeinsam haben, arbeiten vor allem in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie zusammen. Vor drei Jahren erfuhr auch die Kooperation im Kultur und Mediensektor eine deutliche Aufwertung. Der Künstleraustausch zwischen Quebec und Bayern soll auch Einblick in die jeweils andere Kultur gewähren.
Zur Musik von Richard Wagners Götterdämmerung bewegt sich die Kamera in einer langsamen Aufwärtsfahrt durch eine Winterlandschaft. Die aus dem Tal aufsteigenden, geheimnisvoll wirkenden Nebel sind jedoch nur der Ausstoß von Schneemaschinen; bunte Abfalleimer und ein grellrotes Schild mit der Aufschrift „Sortie d’urgence“ betonen das Künstliche der Szenerie. Die Videoinstallation Tremblant des 39jährigen Müncheners Christoph Brech zeigt das bekannte Quebecker Skigebiet Mont Tremblant als surreale Traumlandschaft und barocke Bühneninszenierung. Kosmetik tritt an die Stelle der Natur.
Christoph Brech ist einer der sieben bayerischen Künstler, die im Rahmen der Kooperation zwischen Quebec und Bayern in Montreal zu Gast sind. Die seit 1989 bestehende Zusammenarbeit zwischen den beiden Regionen erhielt 1997 mit der Eröffnung einer Quebecker Delegation in München eine institutionelle Verankerung. Die eigenständigen Außenkontakte der einzigen französischsprachigen Provinz Kanadas sind Teil der gegen Ottawa gerichteten Emanzipationsbestrebungen. Dass Bayern sich Freistaat nennt und als einziges Bundesland das Grundgesetz nicht unterzeichnet hat, legen die nach Unabhängigkeit strebenden und mit der kanadischen Verfassung hadernden quebecer Politiker (so der bis 2003 amtierende Premierminister Bernard Landry) gern in ihrem Sinne aus. Seit 1999 hat auch Bayern einen festen Sitz in Quebec – jedoch nicht in der Hauptstadt, sondern in der wirtschaftlichen und kulturellen Metropole Montreal; und in den vergangenen Jahren wurde der Rahmen der zunächst wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Kooperation auch auf kulturelle Belange ausgeweitet.
Atelierstipendien
So rief man in jüngster Zeit eine dreimonatige Medienausbildung in der jeweils anderen Region sowie einen Künstleraustausch in Form von jeweils einjährigen Atelierstipendien ins Leben.Vom 1. April 2002 bis zum 31. März 2003 lebten und arbeiteten sechs quebecer Künstler aus den Sparten Literatur, Musik und bildende Kunst im Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg. Im Gegenzug beherbergt Quebec seit dem 1. April 2003 sieben bayerische Künstler in Montreal. Nach Benoît-Jean Bernard, dem Leiter der Vertretung der Regierung von Quebec für die deutschsprachigen Länder, ist die Kultur in Quebec Ausdruck der eigenen Identität inmitten des anglophonen nordamerikanischen Kontinents; sie sei damit auch Ort der Reflexion und des Dialogs mit der Welt.
Bei diesem Dialog waren die Quebecker Stipendiaten in Deutschland, sofern sie nicht auf Französisch sprechende Deutsche trafen, dann aber doch auf die Lingua Franca Englisch angewiesen, da sie das Idiom des Gastgeberlandes nicht beherrschten. Für die Autoren Suzanne Marcil und Nicolas Dickner war ein Gedankenaustausch über die literarische Arbeit mit deutschen Kollegen darum kaum möglich. Obwohl Quebec die Internationalisierung der Bildung auf seine Fahnen geschrieben und Marc Champeau vom Quebecker Erziehungsministerium für seine Bemühungen um ein internationales Sprachassistentenprogramm vor kurzem das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten hat, ist der Fremdsprachenunterricht in der französischen Provinz lamentabel. Außer freiwilligen Spanischkursen wird in den Primär- und Sekundarschulen (also bis zum 11. Schuljahr) keine zweite Fremdsprache angeboten. Dieses Manko macht sich auch in anderen Bereichen der bayerisch-Quebecker Kooperation bemerkbar: Die Quebecker Regierung konnte wiederholt ihre drei Forschungsstipendien für Bayern nicht vergeben, da sich keine entsprechend qualifizierten Studenten fanden; auch der seit 1993/1994 bestehende Schüleraustausch leidet unter der Sprachbarriere auf Quebecker Seite.
Dem 53jährigen Gitarristen und Komponisten André Duchesne, einem der Stipendiaten in Bamberg, kam in dieser Situation die universelle Sprache der Musik zu Hilfe. Dem Improvisationskünstler behagte es nicht in der eingefahrenen Kulturszene der Villa Concordia, zu deren Veranstaltungen sich immer nur das gleiche Häuflein Verlorener eingefunden habe. Zu einem Wechselspiel mit den lokalen Künstlern könne es da nur schwer kommen. Der dynamische Quebecer suchte den direkten Kontakt auf der Straße. Mit dem Schlagzeuger Frank Taschner und dem Computersounddesigner Mathias Kundmüller trat er vor einem großem und vorwiegend jungen Publikum im Konzertkeller des Bamberger Jazzclubs auf. Das Ergebnis dieses fränkischkanadischen Mixes – ein Beweis, dass kulturelle Begegnung oft außerhalb elitärer Zirkel stattfindet – soll demnächst auf CD erscheinen.
Auch für den kanadischen Bildhauer Michel Saulnier war die Verständigung mit den deutschen Kollegen in seinem Medium etwas leichter. Wie einigen seiner Mitstipendiaten fiel ihm auf, wie leidenschaftlich die Deutschen diskutieren, immer höchste Ansprüche stellen und vor strenger Kritik nicht zurückscheuen. Die bayerischen Gäste in Montreal hingegen beklagen einhellig eine mangelnde Kultur der Kritik und Diskussion in Quebec. Es werde sehr viel ausgestellt, so die Grafikdesignerin Gesine Dorschner, an der Concordia University könnten bereits Studenten im ersten Semester ihre Arbeiten präsentieren, doch es fehle der theoretische und kritische Diskurs. „Man lobt prinzipiell alles“, so der Filmstudent Christoph Keimel, „die Freundlichkeit steht einer ernsthaften Auseinandersetzung oft im Weg.“
Was die Literaturszene betrifft, so haben es deutsche Autoren in den Augen Suzanne Marcils schwerer als frankokanadische. „Die Konkurrenz ist größer, und es gibt keine staatliche Förderung wie in Quebec.“ Ihr Landsmann Nicolas Dickner zeigt sich beeindruckt davon, wie viele Jugendromane es in Deutschland gebe und wie wichtig man dort dieses in Quebec unterrepräsentierte Genre nehme. Dem jungen Quebecker Romancier fiel in Gesprächen mit deutschen Kollegen auf, wie global die Literaten heute dächten. „Wir haben sehr viel über japanische und amerikanische Autoren gesprochen, kaum über Quebecker und deutsche.“ Dickner sieht darin ein Zeichen dafür, dass man sowohl in Quebec als auch in Deutschland in multikulturellen Gesellschaften lebe.
Multikulturalismus und getrennte Welten
Multikulturalismus erleben die Gäste in Montreal jedoch in weit höherem Ausmaß als die Quebecer in Bamberg. Allein bei einer Busfahrt höre man oft Gespräche in vier, fünf Sprachen. Als erholsam empfinden die Deutschen den beschaulichen Rhythmus der Metropole, Hektik sei unbekannt. Während die bayrischen Medienfachleute die Stadt im Sankt-Lorenz-Strom als wahres El Dorado erleben – nicht nur wegen Soft Image, der weltbekannten Firma im 3D-Bereich, sondern auch wegen eines Unternehmens wie Bas-Image, das fast alle special effects produziert, die man im Fernsehen sieht – , sind die bayerischen Künstler von der lokalen Szene etwas enttäuscht. „Die Kulturmetropole New York ist einfach zu nah,“ meint Christoph Brech, „viele gute Künstler wandern ab. Auch in Toronto sind die Ausstellungsmöglichkeiten für zeitgenössische Kunst wesentlich besser, die Mehrzahl der international anerkannten Galerien sitzt in Kanadas größter Stadt, nicht in Montreal.“
Die Montrealer Musikszene ist in den Augen des Komponisten Georg Haider in eine anglophone und eine frankophone Welt getrennt (besser: unterteilt). „In der frankophonen Szene ist man ganz an Paris und dem Spektralismus orientiert.“ Der Spektralismus, eine Weiterführung des Minimalismus, bei der Naturtöne integriert werden, war in den achtziger und neunziger Jahren eine wichtige Strömung in Paris, ist dort aber inzwischen passé. Spannend findet Haider, dass für die Komponisten in Montreal die Filmmusik eine große Rolle spiele, überhaupt sei die Trennlinie zwischen ernster und unterhaltsamer (besser: unterhaltender) Musik nicht so scharf wie in Deutschland. Leider gäbe es auch im Musiksektor das Problem der Abwanderung: Wer Erfolg hat, verlässt die Stadt. Der bayerische Komponist entdeckte in Montreal jedoch das Streichquartett Bozzini, das sein, während des Aufenthalts in Kanada entstandenes, Scherzo funèbre auf dem Münchener A*Devantgarde-Festival 2005 aufführen wird. Besonderes Glück hatte Christoph Brech: Seine in Montreal gezeigten Videoinstallationen beeindruckten den bekannten kanadischen Kunstkritiker James D. Campbell so sehr, dass er unter dem Titel Passageworks ein Buch über sämtliche Videoarbeiten des Müncheners vorbereitet. Quebec und Bayern finanzieren dieses Buchprojekt zu gleichen Teilen.
Eine Fortführung der Atelierprogramme ist zunächst nicht vorgesehen, doch der Künstleraustausch zwischen den beiden Regionen soll von beiden Delegationen weiterhin gefördert werden. Deutsche werden sich bereits diesen Herbst einen Eindruck von der aufregenden Quebecker Tanzszene verschaffen können. Bei DANCE 2004, dem internationalen Tanzfestival in München (vom 26. Oktober bis zum 7. November), wird Quebec, das 2002 den Festivalschwerpunkt darstellte, wieder mit drei bis vier Tanzkompanien vertreten sein; und die gehören durchaus zur Weltspitze.
Eine etwas kürzere Fassung dieses Artikels erschien am 5.März 2004 in der Neuen Zürcher Zeitung.
Quiz zum neueren deutschen Film
Wolfgang Krotter, Montréal
1. Wie heißt der Film, in dem sich eine junge Frau innerhalb kürzester Zeit 100.000 DM beschaffen muss?
a) Lena steht
b) Christa geht
c) Mona joggt
d) Lola rennt
2. Wie heißt der Regisseur des Films "Gegen die Wand," der bei der Berlinale 2004 den Goldenen Bären gewonnen hat?
a) Wim Wenders
b) Romuald Karmakar
c) Margarethe von Trotta
d) Fatih Akin
3. Im Jahr 1986 erhielt zum letzten Mal ein deutscher Film den Goldenen Bären der Berlinale. Wie heißen Regisseur und Film?
a) Die Sehnsucht der Veronika Voss von Rainer Werner Fassbinder
b) Sonnenallee von Leander Haußmann
c) Das Boot von Wolfgang Petersen
d) Stammheim von Reinhard Hauff
4. Wie heißt der Film, in dem ein scheinbar vom Tode auferstandener Hase eine zentrale Rolle spielt?
a) Das weiße Rauschen (2002)
b) Lammbock (2001)
c) Nach fünf im Urwald (1995)
d) Absolute Giganten (1999)
5. Gesucht werden die Gattung und der Name des Haustieres, das den Hauptakteuren von Halbe Treppe (Regisseur: Andreas Dresen, 2002) entkommt und damit ihre Sehnsucht nach mehr Freiheit versinnbildlicht.
a) Waldi, der Dackel
b) Goldi, der Hamster
c) Hans-Peter, der Wellensittich
d) Schnucki, die Katze
6. Wie heißt der österreichische Film des Regisseurs Ulrich Seidl, der beim Filmfestival in Venedig 2001 den großen Preis der Jury gewann und der Methoden des Dokumentarfilms mit Methoden des Spielfilms vereinigt?
a) Katzenjammer
b) Hundstage
c) Vogelwild
d) Schweinekalt
7. Wie heisst der Regisseuer der Filme Die Unberührbare (2000) und Der alte Affe Angst (2003)?
a) Doris Dörrie
b) Sönke Wortmann
c) Werner Herzog
d) Oskar Röhler
8. Welcher der folgenden Filme stammt nicht von Hans-Christian Schmid?
a) Nach fünf im Urwald (1995)
b) 23 (1998)
c) Anatomie (2000)
d) Lichter (2002)
9. Welcher amerikanische Schauspieler spielt eine Hauptrolle in Wim Wenders Der Himmel über Berlin (1987)?
a) Bill Murray
b) Peter Falk
c) Johnny Depp
d) Jack Nicholson
10. Welcher der folgenden Filme ist der kommerziell erfolgreichste deutsche Kinofilm aller Zeiten?
a) Goodbye, Lenin (2003)
b) Der Schuh des Manitu (2001)
c) Himmel über Berlin (1987)
d) Die Ehe der Maria Braun (1979)
11. Welcher der folgenden Filme von Andreas Dresen ist kein Spiel- sondern eindeutig ein Dokumentarfilm?
a) Nachtgestalten (1999)
b) Die Polizistin (2000)
c) Halbe Treppe (2002)
d) Herr Wichmann von der CDU (2003)
Lösungen: 1.d), 2.d), 3.d), 4.c), 5.c), 6.b), 7.d), 8.c), 9.b), 10.b), 11.d)
Text und Theater: Brecht im Sprachunterricht
Jill Scott, Kingston
Kursbeschreibung
Das Theaterprojekt zur Dreigroschenoper wurde als Teil eines Seminars für fortgeschrittene Studentinnen und Studenten (im dritten und vierten Jahr ihres Studiums) in der Germanistik an der Queen’s University konzipiert. Im Rahmen des zwölfwöchigen Kurses „Modernism and the German Imagination” wurden einige kürzere und etliche längere Texte von verschiedenen Autoren und Epochen behandelt. Der Kurs war als Einführung in die deutschsprachige Moderne gedacht und sollte dementsprechend vielfältig sein (sehen Sie die Kursbeschreibung im Anhang). Aus verschiedenen administrativen Gründen, auf die hier nicht näher eingegangen wird, musste der Kurs zweisprachig gestaltet werden.
Bei solchen Kursen ist es wichtig, so viele verschiedene Sprachübungen wie möglich einzubauen. Es geht um Spracherwerb, allgemeine Kulturgeschichte, Textanalyse und –interpretation. Lesen und Schreiben sind in der Regel der Schwerpunkt eines solchen Kurses, und Hören und Sprechen werden bisweilen vernachlässigt. Deshalb wurde hier, in Form einer kurzen Theateraufführung, der mündlichen Spracharbeit besondere Beachtung gewidmet.
Projektbeschreibung
Es ist nichts Neues, Theater als pädagogisches Mittel anzuwenden. In der angewandten Linguistik wird sehr viel zu diesem Thema geforscht, aber in dem Seminar sollte diese Theorie in die Praxis umgesetzt werden.
Bei Projekten wie dem vorliegenden kommen vielerlei Fragen auf, die zunächst durchdacht werden müssen: Welche Periode? Welcher Autor? Welches Stück? Welche Szene?
Die Entscheidung für Brecht war logisch, denn die Dreigroschenoper passt ideal zum Kursinhalt und dem Thema der Weimarer Republik. Es wäre wünschenswert, dass die Studenten bei der Szenenauswahl mitwirken. Aus Zeitgründen wurde die Hochzeitsszene ausgesucht, weil sie im Mittelpunkt des Textes steht und viele Schauspieler benötigt werden.
Insgesamt wurden diesem Projekt drei Wochen gewidmet, und im nachhinein wurde klar, dass diese Zeitspanne nicht ausreichend war. Auf der anderen Seite muss auch berücksichtigt werden, dass das Semester nur zwölf Wochen hat.
Projektziele
Spracherwerb
- Hörverständnis ergänzen
- Aussprache verfeinern
- Sprachgefühl entwickeln
Lernen
- abwechslungsreichen Unterricht gestalten
- unterschiedliche Lernweisen unterstützen
- aktiv lernen
- Körper und Kopf gleichzeitig beteiligen
Theater
- Brechts Dreigroschenoper einführen
- geschichtlichen Hintergrund des Stückes und der Weimarer Republik behandeln
- Verfremdungseffekt, episches Theater diskutieren
- Das Stück literarisch analysieren und interpretieren
- Die Rolle der Musik betrachten
- Charakterentwicklung besprechen
- Bühnenbau, Beleuchtung, Kostüme ausarbeiten
Probleme
- unterschiedliche Sprachkenntnisse und Fähigkeiten (ein Muttersprachler, Deutschlernende mit 38 Jahren Sprachunterricht, ein Student ohne Deutschkenntnisse)
- ungleiche Rollen
- unterschiedliche Theatererfahrungen und Interesse
- Gruppenarbeit – das Team motivieren
- auswendig lernen?
- öffentliche Aufführung?
- Zeitdruck – Szene kürzen, Zeilen streichen, zusätzliche Probestunden einbauen
Teamwork – Zeitaufteilung
1. Woche
- Brecht
- episches Theater,Verfremdungseffekt
- Textanalyse
- G.W. Pabsts 1931 Filmadaptation – Vergleich der Hochzeitsszene
2. Woche
- Rollenverteilung
- Lesen
- erste Proben in zwei Gruppen mit einer Assistentin
- Aussprache üben und verbessern
3. Woche
- proben, proben, proben in kleinen Gruppen und mit allen Studenten
- Bühne, Musik, Kostüme besprechen und skizzieren
Benotung/Aufgaben
- Anwesenheit und Teilnahme 50%
- Bericht schreiben (2 Seiten) 50%
- Fragen zur Projektteilnahme: Was haben Sie von diesem Projekt gelernt? Welche Kritiken oder Vorschläge hätten Sie? Beschreiben Sie den Lernprozess.
Das Ergebnis – Was die Studenten sagten:
Positiv
- Wir hatten Spaß am Lernen
- Wir haben einander besser kennen gelernt (bei den schlechten Bedingungen an der Universität ist das oft nicht möglich und wird dementsprechend geschätzt)
- Wir sprechen selbstbewusster und ohne Hemmungen
- Wir haben unseren Wortschatz erweitert und lustige Redewendungen gelernt
- Der Text wurde lebendig
- Wir entdeckten den Humor im Text (Humor bei den Proben!)
- Der Körper und der Kopf waren gleichzeitig beteiligt
- Das Projekt ermöglichte eine schöne Abwechslung zu Hausarbeiten und Prüfungen
Negativ
- Die Szene war zu lang
- Die Sprache war zu schwierig
- Die Musik war problematisch – sollten wir die Lieder singen oder sprechen?
- Die Dreigroschenoper ist untypisch für Brecht und den Verfremdungseffekt
- Die Rollenverteilung war ungleich
- Wir hatten zu wenig Zeit, das Projekt war zu zeitaufwendig
- Ich habe kein Interesse am Theater
Ein Student schrieb: “Insgesamt muss ich sagen, dass das Ganze eine spaßige Aktion war, die mir jedoch nicht unbedingt die ‘Geheimnisse’ oder besser gesagt die sozialen Themen, die Brecht anschneidet, entschlüsselt hat. Eine genaue Auflistung und Textanalyse hätte dies für mich auch getan. Ich bin mir jedoch sicher, dass es für Deutschlernende eine bereichernde Betätigung war, da sie die Sprache sprechen konnten und nicht nur stupide einem Text folgen mussten, sondern diesen aktiv erleben konnten.” RK
Insgesamt berichteten die Studenten mehr Positives als Negatives. Darüber hinaus muss bedacht werden, dass Studenten der Lehrkraft gegenüber selten absolut offen sind. Es gibt immer eine Grenze, die nicht überschritten wird, denn letzten Endes ist der Dozent für die Note zuständig.
Mein Ergebnis – wäre es sinnvoll dieses Projekt noch einmal zu versuchen? Was sollte anders gemacht werden?
Auf alle Fälle wird in Zukunft Theaterarbeit Teil meines Unterrichts bleiben.
Ein anderes Stück wäre jedoch zu diesem Zweck besser geeignet, z.B. Der gute Mensch von Sezuan oder Mutter Courage, die sprachlich und inhaltlich einfacher sind und explizit den Verfremdungseffekt integrieren.
Es muss unbedingt mehr Unterrichtszeit für das Theaterprojekt aufgewendet werden, mindestens fünf bis sechs Wochen. Dann können die Studenten auch an der Szenenauswahl teilnehmen, das Bühnenbild entwerfen, den Text auswendig lernen, die Musik und Kostüme ausarbeiten und die Szene öffentlich vorführen.
Andererseits muss bedacht werden, dass den Studenten unseres Programms nur wenige Kurse zur Auswahl zur Verfügung stehen, also ist das für unsere Majors praktisch ein Pflichtkurs. Wenn sich ein Student nicht für das Theater interessiert, wäre es unfair, ihn zur Teilnahme an einem längeren Theaterprojekt zu zwingen.
Anhang: GRMN 331/431 Course Outline (gekürzte Fassung): Modernity and the German Imagination
This course is intended as an introduction to several literary periods and movements in the first half of the twentieth century. Students will become familiar with a wide variety of texts and genres ranging from the prose of turnofthecentury Vienna to expressionist film and Weimar drama.The aim of the course is to provide the building blocks for future study in the fields of German literature and cultural studies: literary and cultural analysis, skills in written and oral communication, group project organization.Three weeks at the end of the course will be devoted to a theatre project and will culminate in an inclass performance of scenes from Brecht’s Dreigroschenoper.
This course is offered simultaneously at two different levels: 331 is a course for students with little or no knowledge of German and involves reading the texts in translation and three contact hours per week; 431 is directed at students who have intermediate language skills.
Evaluation:
Participation
and Attendance: 10%
Study
questions (331) / presentation (431): 2 x 5 = 10%
In-class
essay: 15%
Theatre
project: 20%
Term
paper: 20%
Final
exam: 25%
Interview mit der Autorin Jana Hensel
Katja Thelen und Christian Weiß, Montréal
Jana Hensel (28) schreibt in Zonenkinder über ihre Kindheit in der DDR, die Erinnerungen an die Wende und über ihren Anpassungsprozess in der Zeit danach. Sie begibt sich auf die Suche nach ihrer Kindheit und merkt, dass ihre Generation ihre Wurzeln meist schnell hinter sich gelassen hat. Sie schildert, wie sie als Kind die radikalen Veränderungen nach dem Fall der Mauer erlebt hat. Die Autorin nennt ihre Generation selbst die „ersten Wessis aus Ostdeutschland“. Eine Generation, die sich dem Leben im „Westen“ angepasst und die eigene Geschichte aus den Augen verloren hat. Die biographische Erzählung ihrer Jugend, eine Hälfte in der DDR, die andere im wiedervereinten Deutschland, rief Begeisterung und Empörung zugleich hervor und führte in ganz Deutschland zu Diskussionen. Lange Zeit führte sie die Bestsellerlisten an und erhielt doch Kritik wegen der fehlenden Kritik am System der DDR. Dieses Interview fand am 21. Oktober 2004 am Goethe-Institut Montréal statt, aus Anlass ihrer dreiwöchigen Lesereise mit insgesamt zwölf Lesungen in Kanada und den USA.
Was hat Sie dazu gebracht, ein Buch über Ihre ostdeutsche Generation zu schreiben?
Die größte Motivation war, dass ich bei der Lektüre von Zeitungen und in Gesprächen mit Leuten immer das Gefühl hatte, dass niemand die Geschichte der Zonenkinder kannte.Vor allem fiel keinem auf, dass die Geschichte der Generation, die ihre Kindheit in der DDR verbrachte und im vereinigten Deutschland erwachsen wurde, völlig unbekannt ist. Im Zuge des Bestsellers Generation Golf [1], der sich mit den Prägungen der gleichaltrigen westdeutschen Generation beschäftigt hat, habe ich immer wieder gemerkt, dass man anhand von Generation Golf über deutsche Jugend spricht und dabei vergisst, dass man nur einen Teil der deutschen Jugend damit meinen kann, da die Biographien von ost- und westdeutschen Dreißigjährigen komplett verschieden sind. Es hat mich vor allem schockiert, dass ostdeutsche Jugendliche im Gespräch zu mir gesagt haben, dass Generation Golf ein tolles Buch sei, und dass es genau so gewesen sei. Die Menschen delegieren unglaublich schnell ihre eigenen Biographien und nehmen etwas an, das man ihnen hinreicht.
Warum haben sich die Ostdeutschen ihre eigenen Generationserfahrungen aus den Medien besorgt?
Es gibt wenige Leute, die sich selber mit sich und ihrer Umwelt auseinander setzen. Die meisten sind dankbar für fremde Reflexionsversuche.
Was können kanadische Studenten in Ihrem Buch über Deutschland erfahren?
Es ist die Geschichte einer Generation, deren Kindheit von ihrem Erwachsenenleben abgeschnitten ist. Ihr Leben ist durch den unglaublichen Bruch in der Mitte geprägt, durch den Mauerfall, durch das Verschwinden aller Insignien von Kindheit.
Das sind zum Beispiel Fernsehsendungen, Kindheitshelden, Spielzeug, Lebensmittel oder Rituale. Alles Vertraute dieser Zonenkinder ist verloren gegangen, gleichzeitig mussten sie sehr früh lernen, mit dem neuen System umzugehen und dort auch zu funktionieren. Das Buch kann viel über die Bundesrepublik erzählen, weil man durch einen fremden Blick, durch jemanden, der hinzukommt, genauer wahrnimmt, was einen umgibt.
Einige Kritiker meinten, es sei ein „Fehler“ gewesen, das Buch über weite Strecken in der „Wir“-Perspektive zu schreiben. Wie rechtfertigen Sie, dass Sie für Ihre ganze Generation sprechen?
Darin liegt das entscheidende Missverständnis: Ich würde mir nie anmaßen, für meine gesamte Generation zu sprechen. Ich habe versucht, so etwas wie einen Beginn zu wagen, ein Gespräch zu eröffnen, indem ich Sachen beschreibe, Argumente eröffne und eben nicht an meiner eigenen Person interessiert bin. Ich möchte nicht über mich sprechen, sondern über Phänomene, Prägungen und Gesellschaft. Das „Wir“ ist der Versuch, eine abstrakte Ebene herzustellen. Jeder soziologische Text schafft sich eine abstrakte Ebene. Im Gegensatz zu mir sind die meisten Autoren allerdings nicht Teil der Gruppe, über die Sie sprechen.
Und warum wechseln Sie in ihrem Text zwischen „Ich“ und „Wir“?
Sowohl das „Ich“ als auch das „Wir“ im Text sind Sprechakte, sind Funktionsträger einer Argumentation. Das „Ich“ ist in der Literatur die authentischste Form, die wir haben. Da ich zu der Gruppe gehöre, die ich beschreibe, brauche ich diese Authentizität.
Florian Illies umreißt sein westdeutsches „Wir“ mit Jugendlichen aus München, Bonn und Westberlin und beschreibt damit die westdeutsche obere Mittelklasse. In welchem ostdeutschen Milieu könnte man das „Wir“ in Ihrem Buch ansiedeln?
Es ist interessant, dass sich niemand über das „Wir“ in Florian Illies Buch beschwert hat. Ich habe das einfach übernommen. Der ostdeutsche Leser ist naiver als der westdeutsche, ist weniger postmodern geschult und liest die Texte authentischer. Der westeuropäische Leser ist alle möglichen Formen von Statement und Positionierungen gewöhnt, er kann sich aus allem etwas für sich herausnehmen. Der ostdeutsche Leser hingegen glaubt tatsächlich, es müsse so sein, wie es im Text steht.
Die verschiedenen Reaktionen erklären sich also daraus, dass das Buch von Ost- und Westdeutschen auf eine andere Art und Weise gelesen wird, und weniger daraus, dass es sich um ein ostdeutsches Thema handelt?
Das kommt dazu. Es gibt einen viel emotionaleren Zugang zu dem Thema, und das hat damit zu tun, dass es sich um den Osten handelt. Es handelt sich um einen abgeschlossenen Raum, die DDR, die eine Art interpretatorische Verfügungsmasse geworden ist, zu der jeder seinen Zugang hat.
Sie stellen den Zonenkindern andere ostdeutsche Jugendliche gegenüber, die sie als „Kids aus Neubrandenburg“ und „kahlrasierte Magdeburger“ bezeichnen. Sind das keine Zonenkinder? Kann man die Zonenkinder doch auf ein soziales Milieu beschränken?
Ich habe natürlich schon über eine gewisse Gruppe von Jugendlichen aus der DDR geschrieben, aber nicht über ein Milieu und nicht über eine Klasse. Im Unterschied zu westeuropäischen Gesellschaften hat der Sozialismus die Ausbildung von scharf abgetrennten Klassen verhindert. Ich schreibe über eine Gruppe von Ostdeutschen, die den Abschluss der 10. Klasse haben und Abitur gemacht haben. Das ist eine sehr große Gruppe. Das merke ich auch an den Briefen, die ich zum Beispiel von Zahnarzthelferinnen bekam, also von Leuten, die nicht studiert haben. Nur soziale Randgruppen können sich damit nicht gemeint fühlen.
War Ihnen der Titel „Zonenkinder“ schon klar, bevor sie das Buch geschrieben haben, oder kam Ihnen die Idee erst während des Schreibens?
Der Titel hat sich erst während des Schreibprozesses ergeben. Ich habe lange nach einem Titel gesucht. Wenn mich jemand fragte, habe ich selber immer gesagt, dass ich aus der Zone komme. Ich habe den Titel „Zonenkinder“ getestet und bemerkt, dass die Abneigung gegen das Wort „Zone“ umso stärker war, je älter die Leute waren. Genau das wollte ich erreichen. Jüngere hatten damit wesentlich weniger Probleme, da sie eine viel größere Distanz zur DDR hatten. Ältere Leute sind unglaublich entsetzt über diesen Titel, weil sie sich dadurch an die fünfziger Jahre erinnert fühlen [Anmerkung der Redaktion: Damals bezeichnete die westdeutsche Propaganda die DDR als „(Sowjet)Zone“]. So trennt dieses Wort die Generationen.
Die Zonenkinder sind sehr optimistisch, was ihre Zukunft und ihre Situation in der Bundesrepublik angeht. Trifft das wirklich auf den Großteil der ostdeutschen Generation zu, die Sie beschreiben?
Das Wort „Optimismus“ ist etwas zu naiv in der Beschreibung. Die Zonenkinder sind gekennzeichnet durch einen energischen Zugriff zur Welt, durch Tatendrang, durch das Gefühl, die Welt formen zu können. Sie haben einen Aufstiegsdrang. Sie wollen in eine Gesellschaft reinkommen und dort auch Verantwortung übernehmen.
Viele Ostdeutsche fühlen sich als Bürger zweiter Klasse. Gilt das für die Zonenkinder nicht oder nicht mehr? Die Rede von den „Bürgern zweiter Klasse“ oder von der „Mauer in den Köpfen“ gehört zu diesen medialen Mythen, die sich länger halten als die Realität. Diese Mythen erzeugen auch so eine Art Denkfaulheit. In den letzten Jahren hat sich viel getan, und es gab eine Emanzipationsbewegung, die sich freigeschaufelt hat von solchen Minderwertigkeitskomplexen. Dazu haben Filme wie „Good-bye Lenin“ oder auch mein Buch beigetragen. Es gibt inzwischen eine gefestigte ostdeutsche Identität.
Ist eine feste ostdeutsche Identität denn wünschenswert?
Es ist immer sinnvoll, zu wissen, wer man ist und wo man herkommt, auch um andere zu erkennen. Der größte Ausdruck der ostdeutschen Identitätskrise in den neunziger Jahren waren der Ausländerhass und die Rechtsradikalität.
Steht die ostdeutsche Identität einer gesamtdeutschen entgegen?
Wahrscheinlich tut sie das ein Stück weit. Aber das ist nur auf den ersten Blick etwas, das gefährlich sein könnte. Deutschland als wiedervereinigtes Land hat viel mehr von einer gestärkten ostdeutschen Identität als von einer krisenhaften.
Aber trägt diese ostdeutsche Identität nicht zum Erhalt der „Mauer in den Köpfen“ bei?
Die Frage ist Teil des Problems: wenn man diese Aussage trifft, dann macht man die Geschichte zur Aufgabe der einen Seite.
Kann man denn sagen, dass die westdeutsche Identität, wenn es sie gibt, zum Erhalt der „Mauer“ beiträgt?
Natürlich gibt es eine westdeutsche Identität, über die man sich viel mehr unterhalten müsste. Auch die hat sich in den letzten fünfzehn Jahren sehr verändert, nicht nur durch den Umzug von Bonn nach Berlin. Hier gibt es eine Stellvertreterdebatte: Durch die permanente Beschäftigung mit dem Osten vergisst man, sich mit der westdeutschen Identität auseinander zu setzen.Auch das wäre nötig. Den Ausdruck „Mauer in den Köpfen“ kann ich nur ganz schwer ertragen. Man muss genau hinsehen und sich fragen, was diese „Mauer in den Köpfen“ bedeutet, ob sie sich nicht permanent verändert. Haben wir das Problem der „Mauer in den Köpfen“ nicht erst seit einigen Monaten?
Warum seit einigen Monaten?
Seit einigen Monaten sind die Umfragewerte so, dass sich viele Westdeutsche die Mauer wieder zurück wünschen. [2] Sie sagen sich, dass sie seit fünfzehn Jahren Millionen und Milliarden von Geldern da rüberschieben und die Ostdeutschen immer noch unzufrieden sind. Darüber muss man reden. Die Stimmung ist heute so schlecht wie nie seit dem Fall der Mauer.
Welche Vor und Nachteile haben junge Ostdeutsche gegenüber Westdeutschen?
Das kann man schwer beantworten. Die Voraussetzungen, unter denen ost und westdeutsche Jugendliche gestartet sind, sind komplett andere. Wenn Ostdeutsche in der Lage sind, dieses Fremdheitsgefühl, das viele noch haben, positiv auszunutzen, ergibt das eine Energie, die Westdeutschen weniger gegeben ist, weil sie in dem System, in dem sie leben, immer schon gelebt haben. Wenn man aus zwei Systemen kommt, dann kann man sich besser zurecht finden. Aber auch das ist ein Mythos, denn jeder ist herausgefordert, etwas aus seinen Möglichkeiten zu machen. Ostdeutsche haben nicht per se Vorteile, sie könnten welche nutzen, wenn sie wollten. Aber auch ein westdeutscher Dreißigjähriger kann in seinem Leben Erfahrungen gemacht haben, die ihn in Extremsituationen brachten und vor persönliche Herausforderungen stellten. Mein Freundeskreis teilt sich komplett in Ost- und Westdeutsche, und ich könnte nie sagen, dass die Westdeutschen weniger interessant sind als die Ostdeutschen.
In Ihrem Buch schreiben Sie, die Westdeutschen hätten eine „gelangweilte postmoderne Jugend“ ohne irgendwelche wichtigen Ereignisse...
Da schreibe ich darüber, was ich dachte, was westdeutsche Jugendliche erlebt hätten. Ich ging sehr lange davon aus, dass denen in ihrem Leben nichts zugestoßen sei, weil ich bei Montagsdemonstrationen und Mauerfall relativ früh in große politische, welthistorische Geschehnisse verwickelt war. Das hielt ich lange für einen großen Vorteil und fühlte mich überlegen. Aber gerade das ist der Lernprozess: Jeder kann aus seinem Leben etwas machen.
Sie beginnen Ihr Buch mit einem Zitat der Gruppe „Die Sterne“: „Wir hatten Sex in den Trümmern und träumten. Wir fanden uns ganz schön bedeutend.“
Ich fand es interessant, ein Zitat einer westdeutschen Band voranzustellen, die aber trotzdem genau ausdrückt, was wir gefühlt haben. Ich hätte natürlich auch eine ostdeutsche Band wie Karat oder Puhdys nehmen können, aber das hätte nicht die gleiche Spannung erzeugt. Ich wollte einer Folklore entgegenwirken. Natürlich bin ich in den letzten fünfzehn Jahren durch westdeutsche Moden geprägt worden: Ich lese westdeutsche Zeitungen, höre westdeutsche Musik und lese westdeutsche Bücher.All das ist Teil meiner Person.
Sie schreiben, dass es keinen Generationenkonflikt gab wie bei den 68ern. Die 68er Generation hat ihren Eltern die Fragen zur Diktatur aber erst 25 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus gestellt: Könnte es sein, dass der eigentliche ostdeutsche Generationenkonflikt noch kommt und dann von den Leuten ausgetragen wird, die überhaupt keine Erinnerungen an die DDR mehr haben?
Es ist richtig, dass der Konflikt erst später stattfand. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass so ein Konflikt noch kommt, da die Täter- und Opfer-Zuschreibungen ja bereits gemacht wurden. Im Grunde genommen gab es nach der Wiedervereinigung einen unterschwelligen Vorwurf der west- an die ostdeutsche Gesellschaft, dass sie eine Täter oder zumindest eine Mitläufergesellschaft war. Da wurden Schuldfragen zwar nicht geklärt, sind aber zumindest angeklungen. Viele Leute, die verstrickt waren, sind auch in ihrer Schuld benannt worden, da ist nach 1945 viel weniger passiert. Nach 1989 hat man viel genauer hingesehen.
Aber sehen denn auch die Kinder der ehemaligen DDR-Bürger genauer auf die Schuldfrage, oder nur die Westdeutschen?
Die Kinder eben nicht, weil die anderen die Schuldarbeit bereits übernommen haben. Es kommt zwischen ostdeutschen Kindern und Eltern zu einer Verbrüderung über die Generationen hinweg gegenüber den fremden Westdeutschen.
Sie beschreiben Ihre Fremdheit bei einem Treffen westeuropäischer Jugendlicher aus Österreich, Italien, Spanien und Westdeutschland, die ihre gemeinsamen Jugenderinnerungen austauschen. Gibt es gemeinsame osteuropäische Erfahrungen, die die Zonenkinder mit jungen Polen und Tschechen teilen?
Die gibt es sicher, aber es gibt einen gewissen Selbsthass unter den osteuropäischen Brüderstaaten. Alle blicken immer nach Westen und vollziehen die gleichen Anpassungsleistungen. Wenn sich der Ostdeutsche mit Polen und Tschechen beschäftigen würde, erschiene ihm das als Rückschritt. Er beschäftigt sich, wie die Polen und die Tschechen, lieber mit den Franzosen und den Spaniern. Insofern wird die gemeinsame Geschichte gar nicht erkannt. Außerdem fallen die Ostdeutschen durch die Wiedervereinigung immer aus dem osteuropäischen Kontext heraus. Der wichtigste Unterschied ist, dass Bürgerrechtler heute in den osteuropäischen Ländern ganz entscheidende Positionen einnehmen. Polen, die Tschechoslowakei und Ungarn konnten sich aus sich selbst heraus reformieren.
Die Westdeutschen in Ihrem Buch trinken fair gehandelten Kaffee und diskutieren über die Probleme der Dritten Welt. Ist für Sie das grünalternative Milieu typisch für Westdeutschland?
Natürlich ist grünalternative Politik westdeutsch. Es ist das Symbol einer unglaublich ausdifferenzierten Gesellschaft, dass sich eine Partei ausschließlich um Umweltschutz kümmern kann. Die Beschreibung von Westdeutschen ist ein augenzwinkernder Versuch, sich damit auseinanderzusetzen. Ich schreibe kein Buch über Westdeutsche. Diese sind allenfalls die Folie, vor der ich die Ostdeutschen beschreiben kann.
Wie
waren die Reaktionen auf das Buch im Osten, wie im
Westen?
Die waren sehr unterschiedlich. Das Buch war binnen weniger Tage im Osten überall Gesprächsthema. Irgendwie hatte man auf das Buch gewartet, es hatte schon in den ersten 14 Tagen unglaubliche Verkaufszahlen. Die Diskussion im Osten war mitunter hysterisch, mitunter euphorisch, auf jeden Fall sehr emotional. Die Reaktionen waren sehr gespalten, und in diesem Spannungsfeld liegt der Erfolg des Buches, da sich keine Einigkeit über den Text etabliert hat. Im Westen kam es hingegen niemals zu einer emotionalen Debatte, das Buch hat die Menschen allenfalls interessiert. Man merkte ganz klar, wessen Geschichte das Buch erzählt.
Wer hat das Buch kritisiert und welche Kritik wurde geäußert?
Bei der Rezeption von „Zonenkindern“ fällt auf, dass es vor allem eine Auseinandersetzung mit der Form gab. Inhaltlich hat mir niemand etwas widerlegt. Die Diskussion konzentrierte sich vor allem auf das „Wir“. Das war eine Stellvertreterdebatte, die dem Inhalt ausgewichen ist und sich auf die Form zurückgezogen hat.
Aber ist die Form in diesem Fall nicht auch Inhalt? Sie schaffen einen gemeinsamen Erlebnishorizont und erzählen anderen Ostdeutschen, wie ihre Kindheit war.
Aber warum ist die Reaktion „Ich hab das doch ganz anders erlebt, was maßt die sich an, das so zu erzählen?!“, und nicht „Warum schreibt sie das so auf, wenn das bei mir ganz anders war?“? Westdeutsche reagieren vollkommen normal auf Generation Golf und sagen „Find ich ein nettes Buch, aber es gehört nicht zu mir“, während ostdeutsche Zonenkinder-Leser häufig aggressiv reagieren. Es geht für mich immer wieder um eine phänomenologische Debatte und nicht um die Entscheidung, wer da eine Deutungshoheit hat. Die beanspruche ich gar nicht. Das mag etwas anmaßend klingen, aber ich glaube nicht, dass ich mich geirrt habe, da ich den Inhalt nie revidieren musste.Vor kurzem ist eine Studie von Allensbach veröffentlicht worden, zu der der SPIEGEL sagt: „Jana Hensel hat Recht, die Zonenkinder sind genau so, wie sie beschrieben wurden“.
Was halten Sie von der Ostalgie-Welle, also zum Beispiel von den Ostalgie-Sendungen, die auf allen Fernsehsendern zur Hauptsendezeit liefen?
Es gab in Ostdeutschland 15 Jahre nach dem Fall der Mauer eine Sehnsucht nach der Erinnerung an ein alltägliches privates Leben, abgekoppelt von dem politischen System. Diese Sehnsucht kann man verstehen. Ob man sie jedoch in der Form von Ostalgie-Shows beantworten darf, ist eine andere Frage. Private Erinnerungen und politische Systeme sind zweierlei Dinge, nur darf man über ostdeutsche alltägliche und private Erfahrungen eben nicht sprechen, weil sie in einer Diktatur stattgefunden haben. In der Bundesrepublik war es zu keinem Zeitpunkt ein Problem, nicht politisch zu sein: Man konnte selbst entscheiden, ob man sich politisch engagiert oder ob man privatisiert. Währenddessen war Privatisierung in der DDR stets eine Reaktion auf das politische System. Die Nische war stets Rückzug und nicht einfach eine ganz legitime Existenzform. Deswegen sind Aussagen über private und alltägliche Erinnerungen auch immer Aussagen über eine politische Diktatur.
Der Vorwurf, dass Ihr Buch die Diktatur ausblendet, ist also kein rein westdeutscher, sondern wird Ihnen auch im Osten gemacht?
Das ist ein typisch ostdeutscher Vorwurf. Aber das ist die Provokation des Buches: Das Wort „Diktatur“ fällt nicht in dem Text, weil es mir eben darum ging, die einfache Aufteilung in Opfer und Täter aufzulösen. Für viele Leute ist es sehr einfach zu sagen, dass die DDR eine Diktatur war und dass sie im falschen System gelebt haben. Sie tun so, als habe es dort kein richtiges Leben gegeben, statt nach dem richtigen Leben im falschen System zu suchen.
Was aber war typisch für die Reaktionen im Westen?
Als erstes Medium hat der SPIEGEL groß auf das Buch reagiert. Das Thema war so neu, dass der – westdeutsche – Redakteur einfach eine Episode aus dem Buch an die andere reihte. Er hätte bestimmt gerne mehr dazu geschrieben, wenn er mehr dazu gewusst hätte. Ich glaube, das ist ganz typisch für den Westen: Plötzlich kam etwas, womit man nicht gerechnet hatte und worüber man sich bisher keine Gedanken gemacht hatte.
Was für eine westdeutsche Reaktion wäre denn wünschenswert gewesen?
Ich frage mich, warum die Menschen dieses Thema immer noch so weit von sich wegschieben, statt es zum Teil ihrer eigenen Geschichte zu machen. Es gibt einen westdeutschen Reflex, die Wiedervereinigung zur Aufgabe der Ostdeutschen zu machen. Man merkt allenfalls ein gewisses Interesse.
Sehen Sie sich als Botschafterin des Ostens im Westen?
Nein, mir ist nur an dem Thema unglaublich gelegen. Weil das Thema nichts mit mir zu tun hat, sondern ein gesellschaftliches Phänomen ist, gerate ich mitunter in die Rolle einer Botschafterin. Allerdings sage ich in Deutschland zu dem Thema nichts mehr, weil ich nicht ewig auf diese Rolle festgelegt werden möchte.
Möchten Sie weiterhin als Schriftstellerin tätig sein? Haben Sie weitere literarische Projekte?
Ich bin allenfalls Autorin, Schriftstellerin war ich nie. Das Buch ist ein erzählendes Sachbuch, ein literarischer Essay. Ich arbeite nicht mit Fiktion, sondern versuche, Realität abzubilden: Ich arbeite also als Journalistin. Die Arbeit ist sehr interessant, sie verschafft mir Zugang zur Welt, zu Menschen und zu Situationen. Das kann natürlich irgendwann wieder in einen neuen Text einfließen, muss es aber nicht.
Wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
ANMERKUNGEN
[1] Florian Illies schildert in seinem Essay Kindheit und Jugend der Westdeutschen, die zwischen 1965-1975 geboren wurden; Florian Illies, Generation Golf. Eine Inspektion, Berlin: Argon 2000.
[2] Anfang September 2004 hatten 24% der Westdeutschen (Ost: 12%, Gesamt: 21%) in einer Umfrage von forsa gesagt, es wäre besser, wenn die Mauer noch stünde; http://www.stern.de/politik/deutschland/index.html?id=529441, 10.9.2004, 18:56.
Multimedia und Unterricht
GOOGLE-Geheimnisse: Tipps zur effizienteren Suche
Susanne Kruse, Montréal
Über einige Tastenkombinationen bzw. sogenannte Shortcuts kann man bei der Benutzung von GOOGLE seine Suche spezifizieren und weitere Serviceangebote der Suchmaschine nutzen:
Shortcuts zur genaueren Suche mit GOOGLE:
• + (Plus-Zeichen): GOOGLE ergänzt bei der Suche sehr gebräuchliche Wörter (wie Artikel etc.) automatisch, wenn man zwischen mehrere Suchbegriffe ein "+"-Zeichen einfügt.
Wenn man z.B. "Tastatur"+"Abkürzung"+"Word" in das Suche-Feld eingibt, sucht GOOGLE nach Verzeichnungen zu Tastaturabkürzungen in Microsoft Word
• intitle: GOOGLE sucht nur nach Treffern in den Titeln von Web-Seiten
Wenn man z.B. intitle:Schokolade in das Suche-Feld eingibt, sucht GOOGLE nach Web-Seiten, in deren Titel das Wort "Schokolade" vorkommt
• inurl: GOOGLE sucht nur in URLs (Universal Resource Locators) von Web-Seiten
Wenn man z.B. inurl:Schokolade in das Suche-Feld eingibt, sucht GOOGLE nur in URLs von Web-Seiten nach dem Stichwort "Schokolade"
• filetype: Mit diesem Schlüssel kann man bestimmen, in welchem Dokumententyp GOOGLE nach der Information suchen soll
Wenn man z.B. filetyp:doc Schokolade in das Suche-Feld eingibt, sucht GOOGLE nur in Word-Dokumenten nach dem Stichwort "Schokolade"
Andere Abkürzungen für bestimmte Dokumentarten:
pdf (Adobe Acrobat)
wk1, wk2 etc. (Lotus 123)
xls (Microsoft Excel)
ppt (Microsoft Powerpoint)
rtf (Rich Text Format
swf (Shockwafe Flash)
ans, txt (Text)
(Quelle: PC World, Oktober 2004)
Virtuelle Links zu „Deutsch als Fremdsprache“
Britta Morzick, Toronto
| www.goethe.de/shop | Material für den DaF-Unterricht beim GI bestellen |
| www.goethe.de/dll/mat/deindex.htm | Material vom GI im Internet |
| www.goethe.de/dll/mat/lak/pav/deindex.htm | Print-, Audio- und Videomaterial des GI |
| www.uni-marburg.de/sprache-in-hessen/ | Menü links: „Deutsche Dialekte“: Die deutschen Dialekte—digital und mit Hörbeispielen |
| www.goethe.de/it/tri/kreuzwort.htm | Leichte Sprachübungen für Deutschlernende mit Grundstufen Niveau. 30 Kreuzworträtsel mit Lösungen |
| www.goethe-verlag.com/tests/ED/ED.HTM | 100 Wortschatztests mit Lösungen |
| www.goethe-verlag.com/lehrersprache.htm | Lehrersprache im Deutschunterricht |
| www.goethe-verlag.com/computer.htm | Computerterminologie für DaF |
| www.goethe.de/z/50/uebungen | Übungen selbst gemacht |
| www.goethe.de/gr/dub/schule/dearbb.htm | Dubliner Arbeitsblätter online |
| www.goethe.de/wm/bar/autoren/delesen.htm | Kommentierte Leseproben (Stamm, Erpenbeck, Hettche) |
| www.goethe.de/z/jetzt/deindex.htm | Jetzt – Das Jugendmagazin der Süddeutschen Zeitung |
| www.goethe.de/z/ekp/deindex.htm | Internet Klassenpatenschaften |
| www.goethe.de/in/d/schulen/laku/landkuninfo.html | Landeskunde Online |
| www.goethe.de/z/50/linaleo/deindex.htm | Lina und Leo – Eine multimediale Städtereise durch Deutschland |
| www.goethe.de/z/50/euroquiz/go.html | Das europäische Jahr der Sprachen – Das Euroquiz |
| www.goethe.de/uk/was/pdf/wiseguys.pdf | Die Wise-Guys: Unterrichtsentwürfe zu ihren Liedern |
| www.goethe.de/dll/mat/auf/lks/deindex.htm | Externe Links des GI |
| www.oatg.org/docs/Resources.htm | Umfangreiche Linksammlung der OATG |
| www.duden.de | Links zum Thema DaF unter „Service“ – „Deutsch“ – „DaF“ |
| www.langenscheidt.de | Internet-Wörterbuch „Networds“ |
| http://libraries.mit.edu/guides/types/flnews/german.html | Deutsche Zeitungen im WWW |
| www.hueber.de/lehrer/daf/index.asp | Aktuelles für DaF vom Hueberverlag |
| www.karl-kirst.de | Landeskunde, Online-Übungen |
| www.juma.de | Juma – Das Jugendmagazin für junge Deutschlerner |
| www.canoo.net | Nachschlagewerk zu Grammatik und Wortschatz |
| www.ralf-kinas.de | Online-Übungen von Ralf Kinas |
| www.fplusd.de | Deutsch-Französische Seite |
| www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-uebungen/suche.php3 | Datenbank: Übungen für den Unterricht |
| www.derweg.org/feste/kultur/feste.html | Christliche Seite: deutsche Feste und Bräuche |
| www.deutsch-online.com | Portal für DaF: Material, Schreibwerkstatt, Links, etc. |
Neues aus der virtuellen Welt
Wolfgang Krotter, Montreal
| COMPUTER | |
| www.A9.com | Neue Suchmaschine—Tochterfirma von AMAZON |
| www.boolean.ca/hotpop/ | POP-Access für Hotmail-Benutzer (Damit kann Hotmail-Mail auch auf Outlook/Outlook Express heruntergeladen werden) |
| www.3m.com/market/office/postit/com_prod/psnotes/ | Post-it notes für den Computer |
| www.BlackViper.com | Nützliche Infos zu Windows |
| www.helponthe.net/ | Hilfe bei allen möglichen Computerproblemen |
| www.wifiplanet.com/ | Alles über WiFi |
| www.broadbandhomecentral.com/ | Alles über den schnellen InternetZugang („Broadband“) |
| www.broadbandreports.com | Noch mehr über den schnellen InternetZugang („Broadband“ |
| www.annoyances.org/ | Probleme mit Windows? Hier gibt´s (einige) Lösungen. |
| LEBEN | |
| www.knowledgehound.com/ | Infos („How to…“) zu allen möglichen Themen |
| www.allexperts.com/ | Infos („How to…“) zu allen möglichen Themen |
| www.googlealert.com | Automatische Updates für Suchergebnisse |
| www.seatguru.com/ | Welcher Sitz im Flugzeug ist der Beste? Hier steht´s. |
| www.hotelchatter.com/ | Offizielles und vor allem Inoffizielles über Hotels |
Sprachwissenschaft, Didaktik, Methodik, Pädagogik und Unterricht
Drama Pedagogy in the Language Classroom: A Workshop
Kim Fordham, Edmonton
As the workshop participants enter the room, there is an antique black top hat on the podium. [1] The top hat begins to introduce the workshop leader, who sits on the floor with her back to the audience. From the top hat’s unique perspective, we hear things which may not be part of a regular conference introduction. [2] A metacognitive analysis demonstrates a myriad of purposes such an introduction could serve in the foreign language classroom. It sets the mood, this is not just another ordinary class. It allows the speaker to remain hidden without eye contact, which helps to break down fear of speaking. Taking on the role of an inanimate object awakens the imagination. In a classroom situation students would be given the time and freedom to choose their object. This in turn arouses curiosity on the part of the other students and this curiosity also entices students to listen more carefully as the inanimate objects describe their peers, further developing their listening and comprehension skills. This type of introduction fosters a deeper insight into our students and each other and allows for a new perspective on the usual introductions we have all done in language classes. Memory is also enhanced, as it is much easier to remember a creative dramatic image. I would like you now, as reader, to consider which object you would choose and why.
After the introduction I ask all participants to stand and walk around calmly, not talking, not even really making eye contact. They are to get used to the space, get to know it, take ownership of it, fill the room. After about a minute, I ask the participants to greet the people they meet as if they have a neutral relationship with these people. After another minute, they are to meet people they cannot stand but to whom they must be polite. The next instruction is to greet the other participants as if they were their boss. The final context is greeting someone they are very glad to see and have not seen in a very long time.
This activity demonstrates that although the words and phrases remain similar, gestures and demeanor have changed, conveying each time a completely different message. Approximating real life greeting situations so much more than is possible sitting in desks, all learners are participating and having fun. As none are singled out, selfconsciousness and fear of making mistakes are tremendously lessened. Movement relaxes the learners which in turn enhances concentration and learning. If we were to recite the phrases sitting in desks we would lose out on a great deal of what makes language so much more than vocabulary and phrases to be memorized. All too often we forget that speech separated from body language, separated from action, is much more difficult to learn and to understand. [3] Can you remember the first time you answered the phone in a foreign language? I know that I avoided it as long as I could.
Short, quick concentration enhancers such as the following ja / nein activity function also as warm ups to encourage relaxation and further risktaking, without which language learning is impossible. [4] With participants standing in a circle, I explain that if one says ja the message keeps going in same direction, nein changes the direction of the message. It can no longer go forward, it must go back where it came from. Ja and nein are two simple words but a context is created and each can imagine various messages within those two words, once again reminding us that the message is so much more than just the words.
There are, of course, many creative ways to have students find a partner. For this workshop I chose the living map, where participants must ask each other where they are from, giving them a reason and purpose to ask and to actually use the information gathered, which in turn enhances memory. When learners are organized geographically in the room, I ask each to choose a partner from as far away as possible.
The participants are then given approximately seven minutes to interview their partner, asking what they need to know in order to introduce their partner well. Rather than subsequently introducing their partners as we have all done in many language classes, the participants become their partner and introduce ‘themselves.’ Taking on a role means portraying a person in all their complexity. Each has information about the role from the conversation but each must also complete the portrayal through improvisation. The person being introduced sits on a chair in front of the speaker. I and the other participants then ask questions that we don’t typically think of in such interview situations and to which the speaker is unlikely to know the answer. This forces the speaker to listen, think quickly and improvise, thereby facilitating the practice of many more language skills than the traditional introduction might. Another tremendous benefit of this exercise is that instead of passively listening (if we are fortunate), students become active participants.The often humorous improvised answers also facilitate group cohesion and enhance memory of fellow students and of language.
Another improvisation exercise from Manfred Schewe which enhances language use and fun in the classroom is the following: Students are divided into groups of three (A, B, C).They perform three short improvisations one after another. A starts the improvisation with: “Do you remember that time when . . .” B and C react verbally and nonverbally. After a couple of minutes, B begins an improvisation with:“I don’t know how, but . . . ”A and C react verbally and nonverbally. Again after a couple of minutes, C begins an improvisation with: “I insist that . . .” B and C react verbally and nonverbally. For feedback it is important to ask:“Was it possible to remain serious in the improvisation? Why or why not?” [5] This feedback leads to discussion of Manfred Schewe’s first and second requirements of dramatic improvisation:“I must be able to accept the fiction” and “I must be able to react very quickly”. [6] I must think myself into the other person and I must be able to react quickly to the questions.
To foster concentration and listening skills, the following exercise, again from Schewe [7], works wonderfully and is a lot of fun. With everyone standing in a circle, the teacher explains the situation: an investigation of a crime. The teacher is the inspector and the students are collectively the one suspect. Students must listen to each other for, as the teacher asks questions, no contradictions in the story can occur. As soon as a contradiction becomes apparent the game is over. It is important to keep the questions irregular, with no logical order, to surprise the students and keep them on their toes. Another variation after having done this activity at least once in class is to have a student be the inspector. Students could also work in partners or groups to come up with possible questions ahead of time to practice writing skills. This exercise builds enhanced concentration, fosters listening skills, speaking skills, comprehension skills. It improves students’ ability to think quickly in the target language because there is no time for translation.
The following is an example of a dramatic action plan that I put together to introduce a poem, Johann Wolfgang von Goethe’s “Erlkönig.” I chose a poem because most students hear poem and groan. I begin with having the students create a mindmap around the concept of a forest. Each person is encouraged to come up and put vocabulary and / or pictures on the board. This functions to activate previous knowledge and learn new vocabulary.
The second step is to create sound scenery of a forest. Students stand in a circle with eyes closed or in a darkened room. One student makes a scary forest noise and all others copy that sound. A second student makes another sound and some copy it and some continue to copy the first. A third student makes another and some choose to copy it and some continue to copy the other two, creating a collage of sounds which set the mood of a dark night in a scary forest.
A third step is to encourage free speech, asking a student to say the first thing going through their head, with no judgement or self-criticism. Giving the instructions before beginning step two, students are aware that I will walk around and touch their shoulder as cue to speak. With no time for translation, students practice spontaneous speech.
I then hand out role cards [8], making sure that there is one of each color in each group. It is very important to choose lines which are key to the poem or text, but that can also be interpreted in a variety of ways, thereby encouraging imagination. For I then ask students to pantomime their phrase, using no language at all. The other group members do not know the other phrases, so they must try to guess what kind of situation each person is in. Students are then asked to each experiment with their phrase, playing with intonation, gestures, etc. to try on their character. Together with the other group members, the students are then to imagine a situation where these phrases could occur and to improvise a scene. Before acting this scene, however it is important that the students get into their chosen character. In order to do this I provide a list of questions each must answer from the perspective of their character. If there is sufficient time, answers could be written down for writing practice. Some sample questions could be (these would, of course, be in the target language):
- Why am I in the forest today?
- What am I doing?
- How old am I?
- What have I been thinking about?
- How am I dressed?
- What kind of a mood am I in?
- What are my plans for the day?
- What is my name?
- Am I usually in the forest? Or is this my first time?
- Am I alone?
After adequate time for answering the questions and for rehearsal, I would then have some of the groups perform their scene. It is always fascinating to observe the variety of scenes created with the same three lines.
These dramatic steps have helped to create motivation on the part of the students to read the poem.They are now interested and want to know who the characters really are and what happens to cause the characters to speak their lines. At this point I may play the music written by Schubert for this poem. The music also helps to set the tone of the dramatic events within the poem. If I had started with the indeed wonderful music, without any other preparation, the students would have still most likely been bored.The students instead actively listen to the reading of the poem for they are curious and already emotionally connected to the text through their own roles. Finally, after hearing the poem, I give students the full text to read and to perform. From this point it is possible to move on to a wider theme of fairy tales, elves, magic etc. with students more eager to learn language that is now more interesting to them.
Reflection is always an important learning phase in a workshop and in the classroom. At the end of the workshop, I ask the following questions and I encourage you to think about what your answers might be:
- Which activity or exercise did you like the most? Why?
- Which was the most difficult? Why?
- Which language skills were practiced through these exercises?
- How is this different from the usual language class?
- Which didactic functions did these various tasks serve?
- In which phase of class work would such tasks be useful?
Of course, we all use role play in our classrooms already. I want to challenge you to go beyond the everyday to the unusual and the bizarre with open-ended possibilities. For, as Friedrich Dürrenmatt writes:“If I show two people having a cup of coffee together and talking about the weather, about politics or fashion, however brilliant their conversation may be, this does not in itself make a dramatic situation or a dramatic dialogue. Something more has to be added to make their chat so special, dramatically charged, doubletracked. If, say, the spectator knows that there is poison in one of the cups, or indeed in both, making the conversation one between two poisoners, then by this stratagem the coffeetime discussion becomes a dramatic situation, on which basis dramatic dialogue becomes possible ...
Without the addition of a dramatic charge, an especial situation, there can be no such thing as dramatic dialogue” (Schewe and Shaw 1993, 9, the author's emphasis). Schewe and Shaw also write,“The realm of the unusual and the odd, even the bizarre, so typical of drama, has been virtually unexplored in the language class. ... drama can provide unique possibilities for language learning: creating an experiential context for a foreign language, injecting motivation to grasp and produce language in that context, and making possible the ‘sparks’ of tension and physical encounter of social interplay.” (1993, 11) I encourage you to investigate drama pedagogy as an extremely fertile addition to the foreign language classroom for I believe that if learners are allowed to learn through dramatic situations, they learn that the language they are learning is indeed a means of communication. Using the methods of drama pedagogy integrates all learners who are having fun experimenting with language and honing their language skills.
NOTES
[1] This article is based on a workshop which I presented at the 2002 CASLT National Conference in P.E.I. in November and at CASLT Chez Vous Symposium in Edmonton in March 2003 entitled “Enliven your Language and Literature Classroom with the Methods of Drama.”
[2] I first experienced this type of introduction in a course on drama pedagogy in Berlin, Germany in the summer of 2001 led by Manfred Schewe of the University of Cork, Ireland. I would like to gratefully acknowledge the Goethe-Institute for the scholarship I received to enable me to participate in this course.
[3] For, as Feldhendler writes, “Language acquisition takes place through global, corporal, sensory, emotional and intellectual involvement, through the taking of a role accompanied by phenomena of projection and identification” (1993, 174). Schewe concurs when he writes, “Wir lehren und lernen eine Sprache mit Kopf, Herz, Hand und Fuß!” (2000, 72).
[4] As Glock writes, “Drama offers students opportunities to take risks, secure in the knowledge that they will not be ridiculed or singled out in front of their peers for making the types of syntactical or pronunciation errors that any second language learner makes.” (1993, 110)
[5] This is my translation of an activity from Manfred Schewe’s article: “Dramapädagogische Übungsformen ” (1995, 5)
[6] This is my translation from Manfred Schewe’s article: “Dramapädagogische Übungsformen ” (1995, 5)
[7] This is my translation of an activity from Manfred Schewe’s article: “Dramapädagogische Übungsformen ” (1995, 5)
[8] Because this was a multilingual conference, I provided the lines in German, English and French:
A. Du liebes Kind,
komm geh mit mir! / You dear child,
come along with me! / Viens,
doux enfant, pars avec moi!
B. Sei ruhig, bleib ruhig,
mein Kind. / Be quiet,
stay quiet, my child.
/ Sois calme,
reste calme mon enfant.
C.
Jetzt fasst er mich an! / Now he’s grabbing hold of me! /
Violà qu’il me touche!
REFERENCES AND SUGGESTIONS FOR FURTHER READING
Butterfield, T. Drama through Language through
Drama.
Kemble Press, 1989.
Dougill, J.
Drama Activities for Language Learning. London: Basingstoke, 1987.
Feldhendler, Daniel.
“Einsatz von dramaturgischen und psychodramatischen Lehr- und
Lernformen in der Fremdsprachenausbildung.” Praktische
Handreichung für Fremdsprachenlehrer. Band
2. Frankfurt a. M.:
Peter Lang, 1992: 415-433.
Feldhendler,
Daniel.“Enacting Life! Proposals for a Relational
Dramaturgy.” Towards Drama as a Method in the Foreign
Language Classroom. Frankfurt a. M.:
Peter Lang, 1993: 171-191.
Glock, Carolyn. “Creating Language Contexts Through Experiential Drama.” Towards Drama as a Method in the Foreign Language Classroom. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 1993: 103-138.
Maley, A. & Duff, A. Szenisches Spiel und freies Sprechen im Fremdsprachenunterricht. München: Hueber, 1985.
Meyer, H & Paradies, L. “Alles nur Spielerei? Ansprüche an eine Spieldidaktik un der Sekundarstufe I.” Pädagogik. 4: 10-16, 1994.
O’Toole, J.& Haseman, B. Dramawise. An Introduction to GCSE Drama. Oxford: Heinemann, 1988.
Schewe, Manfred. “Dramapädagogisch Lehren und Lernen.” Praktische Handreichung für Fremdsprachenlehrer. Zweite, verbesserte und erweiterte Auflage. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 1998: 334-340.
Schewe, Manfred. “Dramapädagogische Übungsformen.” In: Michael Legutke (Hrsg.): Handbuch für Spracharbeit. 3. Band, Teil 6.3.1, München 1995, Goethe-Institut, 6.3.1, 19.
Schewe, Manfred. Fremdsprache inszenieren. Zur Fundierung einer dramapädagogischen Lehr und Lernpraxis. Oldenburg: Zentrum für pädagogische Berufspraxis, 1993.
Schewe, Manfred. “Lehren und Lernen mit Kopf, Herz, Hand und Fuß. Dramapädagogische Fremdsprachenpraxis.” Fremdsprache Deutsch. Sonderheft 1993/II: 44-52.
Schewe, Manfred, Schlemmiger, Gerald & Byrsch, Thomas, ed. Pädagogische Konzepte für einen ganzheitlichen DaF-Unterricht. Berlin: Cornelsen, 2000.
Schewe, Manfred & Shaw, Peter, ed. Towards Drama as a Method in the Foreign Language Classroom. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 1993.
Schewe, Manfred. “Zum methodischen Potential von Standbildern im DaF-Unterricht.” Materialien Deutsch als Fremdsprache. Band 40. Regensburg, 1994.
Learning grammar in German 100: One way to understanding English grammar?
Ulf Schütze, Vancouver
The present study investigated in what ways learning a foreign language at the university entry level has an impact on the understanding of English grammar. Two groups of participants were analyzed, all of whom spoke English as the L1. Participants of Group A were enrolled in a first year German (L2) course, participants of Group B in a first year Biology course.Three aspects of English grammar were tested: confusion between an adverb and an adjective, incorrect forms of a verb, incorrect tenses of a verb. Results showed that over the time period of one term both groups did improve their understanding of these aspects of English grammar. Students in Group A improved more than students of Group B; however, in neither group the improvements were statistically significant.
Introduction
Foreign language teachers in North America often report that first year undergraduate students have a poor understanding of English grammar. In a multicultural classroom it can be argued that English is not the L1 of some students. However, research by Bloor (1986) in the United Kingdom, and Lowe and Wales (1996) in Australia found that secondary school learners and undergraduate students indeed show a remarkable low level in understanding English grammar even if the L1 is English. Studies on metalinguistic knowledge which followed up on these findings (Alderson, Clapham and Steel 1997; Elder, Warren, Hajek, Munwaring and Davies 1999) confirmed this.
Little is known about a possible link between studying a foreign language (L2) and the understanding of English (L1) grammar of students. Recent research on the lexicon showed that at a low level of foreign language proficiency the L2 interferes with the L1, that is the acquisition of new information to the lexicon when learning an L2 impacts the processing of L1 because it takes time and practice to integrate this new information into the lexical network of L1 and L2. It is something that is achieved by highly bilingual speakers (Jared and Kroll 2001; Kroll, Michael,Tokowicz, and Dofour 2002).
The present study investigated if studying a foreign language has an impact on the grammatical understanding of the L1. There were three possible outcomes. The L2 could interfere with the L1 as Kroll, Michael, Tokowicz, and Dofour (2002) found for the lexicon, learning an L2 could improve the understanding of L1 grammar, or there could be no link.
Method
The study was carried out with two groups. Group A consisted of 48 foreign language students who were enrolled in German 100 (first year course). Group B consisted of 48 science students. Students of both groups were aged 17 to 19, in their freshman year at the University of British Columbia, and their L1 was English. Students of Group A did not know any other foreign languages besides studying German (L2), students of Group B did not know any foreign language. This requirement was imposed on the selection of participants to avoid interference between foreign languages. Students of Group B were enrolled in Biology. A questionnaire that was handed to all students in German and Biology prior to selection for the study ensured they would fit the required profile. [1]
All students performed the same task. They were tested on ten sentences of the LPI (Language Proficiency Index) Test that is used at the University of British Columbia to assess first year students’ knowledge of English.
The LPI Test consists of four sections testing ‘sentence structure’, ‘English usage’, ‘reading comprehension’ and ‘essay writing’. In the present study, only ‘sentence structure’ was tested. That section has a multiple choice format. Nine usage errors are tested: (1) incorrect use of ‘a’ or ‘the’, (2) incorrect plural of a noun, (3) incorrect form of a noun or incorrect use of a noun,
(4) wrong case of a pronoun, (5) confusion between an adverb and an adjective, (6) incorrect form of a verb, (7) incorrect tense of a verb, (8) incorrect preposition, (9) a nonstandard English expression or idiom. In the present study, errors number 5, 6, and 7 were tested because learning about verbs, adverbs and adjective plays a central role in German 100.
The ten questions were broken down into four sentences that tested confusion between an adverb and an adjective, four sentences that tested incorrect form or tense of a verb, and two correct sentences. [2]
The test was carried out twice.The first test was done during the second week of the beginning of Term I (September). The second test, following the same grammatical format as the first test but changing the content of the questions, was carried out at the end of Term I (December).
Results were analyzed using inferential statistical methods reporting the mean, the standard deviation and the t-value (paired samples t-test) to determine if differences between the two populations compared were significant.
Results and Discussion
In Group A, the average score of the 48 students in the LPI test carried out in September was 8.42 out of 10. In December it was 8.96. Although students improved their understanding of English grammar on the three aspects tested, the paired samples t-test showed no significant improvement (see Table 1). In Group B, the average score of the 48 students in September was 7.67 and in December 8.00. Differences were not significant, either (see Table 1).
TABLE 1: Paired samples t-test comparing the September scores with the December scores of Group A and Group B
| Mean |
SD |
Mean |
SD |
t-value |
Sig. (p) |
|
| SEPTEMBER |
SEPTEMBER |
DECEMBER |
DECEMBER |
|||
| Group A | 8.42 |
1.54 |
8.96 |
1.01 |
1.908 |
.063 |
| Group B | 7.67 |
1.33 |
8.00 |
1.54 |
1.112 |
.272 |
The data shows that the mean score of students in Group A was higher both times the test was taken compared to students in Group B. The decision to enrol in a foreign language or a biology course as a freshman is often made by personal interest. Students to enrol in a biology course were more likely to take more science and less English courses in highschool and therefore score lower on a test on English grammar. More importantly, the question under investigation was in what way students improve their understanding of English grammar over the course of one term at the entry university level. The results show that both groups improved. In fact, students of Group A improved more than students of Group B. In Group A the foreign language instruction has an impact on the students understanding of English grammar. The aspects under investigation (verbs, adverbs and adjectives) are part of the curriculum of German 100. Although the use of these aspects of grammar is quite different in German compared to English, textbooks and instructors often draw parallels to English to explain particular features of these aspects. Consequently, students learn more about English grammar. For Group B one possible explanation is that instruction in the English language, classes in the sciences are taught in English at UBC, also improves students’ understanding of English grammar even if the instruction does not involve the teaching of English but of other subjects such as Biology. Students receive English input in Biology classes which seem to have an effect on their understanding of English grammar. [3]
In summary, learning an L2 does improve the understanding of L1 grammar on the aspects tested. The question remains why improvements of Group A are not significant. One answer might lie in the sample number of 48 students which in statistical terms is rather small.Another explanation could be that the time period of one term is not sufficient enough for students to fully apply the new information learned in the foreign language course to their understanding of English grammar. Additional studies taking these factors into account are planned.
NOTES
[1] A sample question was: ‘Please indicate for all languages you learned the following information: Age (how old you were when you started learning it, e.g., L1: birth), Number of years learned, Name and Number of courses taken/Number of hours per week per course (L2/L3 only), Country you learned it (e.g. L2: German. Learned in Canada), How you learned it (at home, highschool, university) L1 (English): L2: L3:
[2] In each sentence four elements were underlined and the student had to indicate which of the four elements was incorrect or if none of the elements were incorrect . For example the following sentence tested confusion between adjective and adverb:‘In one of my favourite photographs, I am standing closely to my grandmother who was visiting in Vancouver last summer.’ The element that is incorrect is ‘standing closely’ which should be ‘standing close’.
[3] Krashen (1981, 1982, 1989) emphasizes the significance of context for the L2 learner and argues that acquisition is the result of comprehensible language input. Van Patten (1996) points out that the learner does not necessarily perceive and process all input he or she receives. Therefore there is a distinction between input and intake. Krashen and Van Patten both work with L2 acquisition whereas in the present study English was the L1 of students. However, it seems that Krashen’s and Van Patten’s findings can be applied to L1 in this case.
REFERENCES
Alderson, J. Charles, Clapham, Caroline and Steel, David (1997). Metalinguistic knowledge, language aptitude and language proficiency. Language Teaching Research 1: 93-121.
Bloor, Thomas (1986).What do language students know about grammar? British Journal of Language Teaching 24: 157-160.
Elder, Cathie, Warren, Jane, Hajek, John, Munwaring, Diane and Davies, Alan (1999). Metalinguistic knowledge: how important is it in studying a language at university? IRAL 22: 8195.
Jared, Debra and Kroll, Judith F. (2001). Do bilinguals activate phonological representations in one or both of their languages when naming words? Journal of Memory and Language 44: 231.
Krashen, S.D. (1981). Second language acquisition and learning. Oxford: Pergamon.
Krashen, S.D. (1982). Principles and practice in second language acquisition. Oxford: Pergamon.
Krashen, S.D. (1989). Language acquisition and language education. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
Kroll, Judith F., Michael, Erica, Tokowicz, Natasha and Dufour, Robert (2002). The development of lexical fluency in a second language. Second Language Research 18 (2): 137-171.
Lowe, M. and Wales, M.L. (1996). Language awareness in L1 and its impact upon progress in L2. In Working papers in Language Teaching and Linguistics, Carmen Arbones-Sola, Jeanne RolinIanziti and Sussex, Roland (eds.), 121-128. University of Queensland, Queensland: Centre for Language Teaching and Research.
Van Patten, Bill (1996). Input processing and grammar instruction: Theory and research. Norwood, NJ: Ablex.
Des Klassenzimmers großes Welttheater. Der “Ohrenzeuge“ und “Wer war Mozart?” an der Wilfrid Laurier Universität
Alexandra Zimmermann, Waterloo
Der Weg zu dem
Kopf durch das
Herz muss geöffnet werden.
(Friedrich Schiller:
Über die ästhetische Erziehung des Menschen)
Ganzheitlicher Anspruch
Hólos ist das griechische Wort für ganz und wir definieren das Konzept des Holismus in den Naturwissenschaften und in der Philosophie als die Überzeugung, dass jedes Phänomen innerhalb eines größeren Kontextes und von einem umfassenden Standpunkt aus analysiert werden muss. Das Ganze wird als wichtiger betrachtet als die Summe seiner Komponenten.
Der holistische Ansatz ist auch auf den Bereich der Pädagogik zu übertragen. Manfred Schewe, Initiator der Dramenpädagogik im Bereich Deutsch als Fremdsprache, begründet den ganzheitlichen Anspruch seines Ansatzes durch die Lehren der pädagogischen Ahnherren, Comenius (1592-1670) und Pestalozzi (1746-1827), die durch die neueren Forschungen aus der Lernpsychologie bestätigt wurden:
Je mehr Wahrnehmungskanäle benutzt werden, desto fester wird das Wissen gespeichert, desto vielfältiger wird es verankert und auch verstanden, desto mehr Schüler werden den Wissensstoff begreifen und später auch wieder erinnern … . Dieses “Lernen mit dem ganzen Organismus, mit Körper, Seele und Geist” nutzt wichtige, im üblichen Unterricht ungenutzte Gehirnpartien. Was mit dem spielerischen Lernen einhergeht – Neugier, Faszination, Erlebnis, Bildhaftigkeit – führt zu einer tieferen Verankerung des Gelernten. (Schewe 1993: 399)
Ganzheitliche Methodik – auch im universitären Bereich des fremdsprachlichen Deutschunterrichts?
Als an der deutschen Sektion der Abteilung für Sprachen und Literatur der Wilfrid Laurier Universität die Einführung eines deutschen Theaterkurses mit abschließender öffentlicher Aufführung für alle Studenten ab dem ersten Jahr Deutsch erwogen wurde, spielten Überlegungen dieser Art durchaus eine Rolle. Der akademische Lehrbetrieb beschränkt sich ja weitgehend auf die kognitive Stimulanz des Intellekts. Ein emotionaler Zugang zu Lerninhalten wird nicht angeboten, die gesamte Körperlichkeit der Studenten nicht wahrgenommen und die individuelle Persönlichkeitsstruktur ignoriert.
Sogenannte alternative Methoden der Fremdsprachenvermittlung, wie Suggestopädie, The Silent Way, Total Physical Response, erfreuen sich wohl zeitweiliger Beliebtheit, um dann in der Lehrpraxis nur noch eklektisch zum Einsatz zu kommen. Ist es den Hochschulprofessoren aber Ernst mit der Verpflichtung, als Erzieher in der Lehre den gleichen Anspruch an sich zu stellen wie als Wissenschaftler in der Forschung, so erscheint es nur folgerichtig zu fordern, Studenten nicht als Teil einer unendlich austauschbaren Masse zu belehren, sondern sie in ihrer Individualität bestmöglich zu fördern. Die Rolle des Dozenten wäre dann als eine Art mentaler Geburtshelfer zu verstehen, der einer komplexen Persönlichkeit zum Leben verhilft.
Im Bereich der Fremdsprachenvermittlung bedeutet dies vorrangig, im Lerner das nötige Selbstvertrauen zu entwickeln, in der Fremdsprache selbstbewusst und souverän zu agieren – sei es nun auf der kleinen Bühne der Universität oder auf der Bühne des “Großen Welttheaters”. Dieses Unterfangen wurde als das Globalziel für den neu geschaffenen deutschen Theaterkurs formuliert.
Die Inszenierungen
Um dem theoretischen Skelett dieses Artikels nun einiges “anschauliches” Fleisch und Blut zu verleihen, soll vorweg kurz von den Inszenierungen der beiden bisher realisierten Theaterkurse die Rede sein.
Im “Ohrenzeuge” dramatisierten wir fünf groteske Charaktere aus Elias Canettis gleichnamiger Sammlung außerordentlicher Charakterstudien.
Der “Ohrenzeuge” war in unserer Interpretation ein unverbesserlicher heimlicher Lauscher, der in der Nazi-Zeit unschuldige Mitbürger, die sich politische Witze erzählen, bei der Gestapo denunziert. Die “Mannsprächtige”, eine glamouröse “femme fatale”, hebt ihre Arme abwechselnd vor dem Spiegel, um ihre männerbetörenden Achseln strahlen zu lassen – aber nur für sich allein und zu ihrem eigenen Vergnügen.
Der “Heimbeißer”, ein Charmeur und Meister im Händeküssen, der den Duft der alten Zeit mit sich bringt, zieht sich bei Abendgesellschaften unbemerkt in ein Zimmer seiner Gastgeber zurück, um dort einen Teil des Mobiliars oder was sich sonst noch im Bereich seiner Möglichkeiten befindet, “abzubeißen” und in seine Tasche zu stecken.
Die “Sultansüchtige” trifft in unserer Interpretation bei einer Abendgesellschaft im Hause Sigmund Freuds auf einen Gast, dessen hypnotische Kräfte bewirken, dass sie sich in eine Haremsdame verwandelt und ihn kurzerhand zu ihrem Sultan macht. Erst der Gong, der alle Gäste zum Nachtmahl ruft, reißt sie aus ihren Haremsphantasien, und der Missetäter wird drastisch bestraft.
Unsere zweite Inszenierung “Wer war Mozart?” war eine spielerische Suche nach der wahren Natur von Mozarts enigmatischer Persönlichkeit. Szenen aus Peter Shaffers “Amadeus” in deutscher Übersetzung präsentierten einen dramatischen Mozart, eine Bühnenfassung von Eduard Mörikes Novelle “Mozart auf der Reise nach Prag” zeigte einen romantischen – oder vielleicht besser: “romantisierten” Mozart und die dramatische Lesung eines der berühmt-berüchtigten “Bäsle”-Briefe an einen jugendlich-despektierlichen “Kindskopf” Mozart. Der inherente dialogische Charakter des Briefes machte es möglich, den Prozess des Schreibens und den Prozess des Lesens in einem simultanen dramatischen Akt darzustellen, wobei Mozart und das Bäsle nur durch eine große weiße Leinwand auf der Bühne voneinander getrennt waren. Eine tänzerische Interpretation von Falcos Rocksong “Rock me Amadeus” aus dem Jahre 1985 und ein abschließender Sketch rundeten schließlich das Mozart-Theaterprojekt ab.
In beiden Inszenierungen wurde dramatischer Dialog mit dem narrativen Text einer Erzählerfigur kombiniert, ein Verfahren, das allerdings des öfteren Probleme in der Dramaturgie verursachte, zumal beide Inszenierungen absoluter Textauthentizität verpflichtet waren (nur Originalzitate aus den literarischen Texten, keine Veränderungen, nur Umstellungen und Kürzungen). Als Bühnenbilder dienten in beiden Inszenierungen mit Hilfe von Power Point auf eine riesige Leinwand projizierte Landschaften, Interieurs, historische Porträts (zum Beispiel Johann Strauss, Mozart, Constanze Weber) und in großen Lettern präsentierte Übersetzungen der Arien und Liedertexte. Dieses Verfahren hat sich sowohl vom künstlerischen als auch vom technischen und ökonomischen Standpunkt aus als äußerst zufriedenstellend erwiesen.
Das Kurskonzept
Wie sieht nun ganz konkret das Kursdesign des deutschen Theaterkurses aus? Es handelt sich um einen einsemestrigen, zwölfwöchigen “half-credit” Kurs, mit 4 wöchentlichen Kontaktstunden (davon 1 Stunde Sprachlabor), also eine Gesamtsumme von 48 Kursstunden und weiteren 10-15 zusätzlichen Tanz- und Probestunden unmittelbar vor der Premiere. Ungefähr die erste Hälfte des Kurses (Wochen 1-5) ist der theoretischen Vorbereitung im Klassenzimmer gewidmet, die zweite Hälfte des Kurses bereits ausschließlich der konkreten Probenarbeit.
Dieser Zeitplan entspringt jedoch institutionellen Zwängen und kann in keiner Weise als befriedigend bewertet werden. Auf jeden Fall vorzuziehen wäre ein einjähriger (zweisemestriger) “full-credit” Kurs (24 Wochen), mit einem vollständigen Theorie- und einem vollständigen Probesemester.
Die Anforderungen, die an die Studenten in einer so kurzen Zeitspanne gestellt werden, sind groß: im theoretischen Teil wird der literarisch-kulturelle Kontext des Projektes vorgestellt, ein intensives phonetisches Training absolviert (sowohl in den Kurs- als auch in den Sprachlaborstunden), das Vokabular mit Hilfe eines umfassenden Glossars erarbeitet und das dramatische Skript gemeinsam gelesen und eingehend analysiert. Dramapädagogische Übungen bereiten bereits spielerisch auf spezifische Aspekte der Inszenierung vor. [1] In der abschließenden Sitzung nach den Aufführungen präsentieren die Studenten einen humorvollen Sketch über ihre Kurs- und Aufführungserfahrungen.
Prozess- vs. Produktorientierung
Wie Birgit Oelschläger anführt, haben sich inzwischen innerhalb der Dramenpädagogik zwei grundsätzlich verschiedene dramenpädagogische Ansätze herausgebildet.
Die zwei zentralen Ausrichtungen, die man gemeinhin unterscheidet, liegen in der Prozess bzw. Produktorientierung. Während am Ende einer produktorientierten Arbeit vor allem eine gemeinsame Inszenierung vor einem Publikum steht und damit meist Wert auf künstlerische Formgebung gelegt wird, stehen bei einer prozessorientierten Arbeit andere Ziele im Vordergrund (Oelschläger 2004: 24).
Ich möchte allerdings ihrer Schlussfolgerung für den Bereich des Fremdsprachenunterrichts widersprechen:
Wenn sich also Fremdsprachenunterricht und Theaterpädagogik begegnen, werden die Mittel des Theaters zu Zwecken des Fremdsprachenerwerbs, meist zur Verbesserung mündlicher Kommunikationsfähigkeit, eingesetzt, und es wird damit eine prozessorientierte Ausrichtung verfolgt (Oelschäger 2004: 24).
Das große Mehr an “Motivation” war deutlich der ausschlaggebende Faktor einer grundsätzlichen Produktorientierung des deutschen Theaterkurses. Alle Kursteilnehmer arbeiten gemeinsam in Teamarbeit mit unterschiedlicher Aufgabenverteilung an einem Endprodukt mit ästhetischem Anspruch. Ich möchte dieses Prinzip, in Anlehnung an Volvos revolutionären Produktionsmodus, den ”Volvo”-Effekt nennen. Die Aussicht, in einer öffentlichen Aufführung glänzen zu können, bewirkt bei den teilnehmenden Studenten oftmals einen ungeheuren Motivationsschub.
Auch Schewe und Scott bestätigen diese Beobachtung für ihr produktorientiertes “Literature through Drama”- Konzept:
Within the
theatre-making teaching
model,
the student of literature becomes the actor/performer who enters the
rehearsal process in the knowledge that when it is over
he/she will perform before a live audience.
This prospect
immediately lends the learning process a dimension of
urgency and anticipation. …
… the student/actor has even more of a vested interest in performing well. Whatever they feel about privately receiving a low mark in a written piece of work, no one wishes to suffer the humiliation of failure in public (Schewe/Scott 2003: 65).
Es besteht kein Zweifel: produktorientierte Dramapädagogik erfordert sehr viel Fingerspitzengefühl von Seiten des Pädagogen: die Fähigkeit, die Leistungspotentiale der Teilnehmer voll auszuschöpfen, aber auch die Grenzen jedes einzelnen realistisch einzuschätzen, um psychologischen Schäden vorzubeugen. Der emotionalen Befindlichkeit der Teilnehmer während der Probenarbeit sollte stets Beachtung geschenkt werden und die Ursachen für Unzufriedenheiten oder Unstimmigkeiten, etwa über Rollenbesetzungen, so früh wie möglich erkannt werden.
Eine von positiven Emotionen getragene Gruppendynamik kann andererseits bei den Kursteilnehmern ungeahnte Leistungspotentiale erschließen. Die Übernahme einer die eigene Identität verbergende Rolle kann sich übrigens im anthropologischen Sinne als entlastend erweisen (gerade für fremdsprachliche Schauspieler), was eine mir bekannte Schauspielerin bestätigte: bei öffentlichen Darbietungen ihrer Gesangsklasse sei sie von großer Nervösität geplagt, da sie ja in eigener Person für ihre Leistungen einstehen müsse, doch vor ihren Bühnenauftritten sei sie nie nervös, denn es sei ja die dramatische Figur, die da auf der Bühne stehe, und nicht sie selbst.
Kein Zweifel aber hierüber: Die öffentliche Theatervorstellung fremdsprachlicher Schauspieler und Schauspielerinnen ist und bleibt eine Mutprobe mit allen implizierten Gefährdungen und potentiellen Katastrophen. Doch welch ein Zugewinn an Selbstvertrauen, wenn diese Mutprobe mit Erfolg bestanden wird.
Bewertung der studentischen Leistungen
Eine der größten Schwierigkeiten bei der Konzeption eines deutschen Theaterkurses stellt sicherlich die Bewertung der studentischen Leistungen dar. Vokabeltests über das Vokabular des dramatischen Skripts (2. Jahr Deutsch: passive Beherrschung, 3. und 4. Jahr Deutsch: aktive Berherrschung) sind eindeutige und absolute Gradmesser studentischer Leistungen.
Fast alle der restlichen Kurskomponenten müssen einem Bewertungsschema unterworfen werden, das der relativen Leistung der Kursteilnehmer Rechnung trägt. Dazu gehört natürlich die Interpretation ihrer dramatischen Rolle und der individuelle Fortschritt, der bei der Verbesserung der Aussprache und Prosodie erzielt wird. Jeweils zu Kursbeginn und zum Kursende wird jeder Kursteilnehmer aufgefordert, ein und dieselbe Textpassage des dramatischen Skripts im Sprachlabor aufzuzeichnen – der detaillierte Vergleich der beiden Aufzeichnungen bildet dann die Grundlage der Bewertung.
Der kursbeschließende Sketch bietet den Kursteilnehmern die Gelegenheit, Erfahrungen und Erlebnisse aus den öffentlichen Aufführungen auf spielerische und humorvolle Weise psychisch aufzuarbeiten. Gleichzeitig wird ihnen ermöglicht, nochmals unter Beweis zu stellen, wie sie während des Kurses und der Aufführungen ihr dramatisches Ausdrucksrepertoire erweitert haben. Mit Ausnahme der präsentierenden Gruppe sind alle anderen Kursteilnehmer anonym an der Bewertung des Sketches beteiligt.
Von hohem pragmatischem und zugleich pädagogischem Nutzen ist die obligatorische aufführungsvorbereitende Gruppenarbeit, die bei der Bewertung der studentischen Leistungen einen großen Raum einnimmt. Die Kursteilnehmer können zwischen folgenden Arbeitsgruppen wählen: Requisiten (Herstellung und Handhabung der Requisiten während der Vorstellungen), Werbung (Verteilung von Postern, elektronische Werbung für spezifische Zielgruppen, Medienkontakte), kreatives Schreiben (wenn die Kursteilnehmer Teile des dramatischen Skripts selbst entwickeln) und Arbeit als Sprachtutoren für Kursteilnehmer auf einem niedrigeren sprachlichen Niveau (mit formal nachgewiesenen wöchentlichen Treffen und einer abschließenden Bewertung des Tutors durch die betreuten Studenten).
Warum nur?
Warum, warum, warum nur? Dies ist wohl die Frage, die sich jeder Dozent eines deutschen Theaterkurses während des Produktionsprozesses stellen wird – mit Sicherheit mehr als einmal und spätestens während der ersten Bühnenprobe, die oftmals alle Beteiligten in panischen Schrecken vor dem scheinbar nie Erreichbaren versetzt.An dieser Stelle sei ein kleiner Exkurs aus dem Nähkästchen der Aufführungspraxis erlaubt – keinesfalls zur Abschreckung, nur zur realistischen Einschätzung der Produktionsarbeit. ProduzentIn, OrganisatorIn, RegisseurIn, BühnenbildnerIn, MusikdesignerIn, BeleuchtungsdesignerIn – dies alles sind Rollen, die je nach institutionellen Rahmenbedingungen vom Dozenten / von der Dozentin zu übernehmen sind und große Erfahrung oder ein äußerst gesundes Maß an Improvisationsvermögen erfordern.
Eine der größten Herausforderungen stellt die Handhabung des meist knapp bemessenen Budgets dar. Ist die nötige Finanzierung gewährleistet, [2] muss oft ohne weitere Verzögerung gehandelt werden, um den Anforderungen der Produktion schnellstmöglich zu entsprechen.
Anekdotisch gesprochen: Dringlicher Auftrag der verantwortlichen Kostümbildnerin an die Dozentin: Männerstrumpfhosen!!! (für die zahlreichen Rokoko-Herren in der “Wer war Mozart?”-Produktion). Die verwirrend-überwältigende Vielfalt des Angebotes im Fachgeschäft macht es unvermeidlich, die wohl indiskreteste E-Mail abzuschicken, die Studenten jemals von einer Dozentin erhalten haben: Was ist Ihre Strumpfhosengröße? Hätten Sie gern eine schwarze Strumpfhose oder würden Sie eine wollweiße Strumpfhose bevorzugen? Die letzten Tage des organisatorischen Marathons vor der Premiere können wohl am besten mit dem Wort “Delirium” umschrieben werden: Unzählige Listen mit unbedingt noch zu erledigenden Dingen erscheinen unablässig und mit größter Hartnäckigkeit vor dem inneren Auge, und die sogenannten “schlaflosen Nächte” verwandeln sich im wörtlichsten Sinne des Wortes in “Nächte ohne Schlaf”.Und doch ist alles aller Mühe wert. Ganz sicher. Und warum? Der deutsche Theaterkurs bringt eine Vielzahl pädagogischer Vorteile mit sich, die konventionelle akademische Kurse einfach nicht anbieten können. Hier eine kleine Zusammenfassung:
Das leidige Auswendiglernen – diesmal aus gutem Grund
Wer bekämpft sie nicht tagtäglich im Sprachunterricht, die große Krise beim Versuch, Sprachstudenten das Auswendiglernen schmackhaft zu machen. Es ist ein harter und mühsamer Kampf, denn viele der Studenten – oftmals die begabtesten – wären wohl eher bereit, einen vierseitigen Aufsatz zu schreiben, als 20 neue Wörter zu memorisieren. Und doch ist und bleibt das Auswendiglernen, wie wir alle wissen, essentiell für den Zweitsprachenerwerb.
Im Gegensatz zu Teilnehmern an einem konventionellen Sprachkurs, wird ein Teilnehmer am deutschen Theaterkurs die Notwendigkeit, den Text der dramatischen Rolle zu memorisieren, jedoch nicht in Frage stellen, um den Erfolg der Vorstellung nicht zu gefährden.
Diese Art der “Einverleibung” des dramatischen Textes bedeutet aus der Sicht des Zweitsprachenerwerbs eine wesentliche Erweiterung des zur aktiven Verfügung stehenden Vokabulars und ein Einschleifen selbst komplexer sprachlicher Strukturen.
Der dramatische Text einer Rolle “beißt” sich erfahrungsgemäß oftmals im Gedächtnis seiner Darsteller fest – und das weit über die eigentlichen Aufführungen hinaus.
So wurde die Replik einer “Witze-Erzählerin” aus dem “Ohrenzeugen” zur sprichwörtlichen Begrüßung unter den darstellenden Studenten:“Irgendwas Politisches?”
Und im abschließenden humoristischen Sketch über die Aufführungserfahrungen in der “Wer war Mozart?”-Produktion bezogen sich die Studenten ironisch auf den Memorisierungsprozess bezüglich ihrer Rollen:
Das Szenario: Toronto – zwanzig Jahre später. Die Teilnehmer am deutschen Theaterkurs sind in einem Irrenhaus gelandet, denn sie können ihren dramatischen Text nicht mehr loswerden. Sie sind für immer und ewig dazu verurteilt, im Kreis herumzulaufen und Repliken wie “Das wär ja höllenmäßig! Das geht ja über alle Begriffe! Ein Wiener Musikus, sagt Ihr?” zu rezitieren.
Be-lebte Literatur
Deutsche Literatur auf Deutsch zu lesen wird immer unbeliebter an nordamerikanischen Universitäten – ohne Zweifel ein beklagenswerter Zustand. Die entscheidende Frage lautet jedoch: Ist dieser Zustand irreversibel? Gewiss ist Schewe und Scott zuzustimmen, die diese Frage zu einer Frage der Methodologie erheben:
Contending that students’ willingness to engage with literature will, in the future depend to a great extent on the use of imaginative methodology on the part of the teacher (Schewe/Scott 2003: 56).
Nur zu unterstreichen ist weiterhin die Feststellung, dass ein “Mehr” an empirischen Forschungsergebnissen in der Literaturdidaktik dringend benötigt wird.
… representatives of “Literaturwissenschaft” have neglected in their research to describe and evaluate the actual teaching and learning processes which take place in literature courses (Schewe/Scott: 2003: 58).
Wie Schewe und Scott sehe ich in der dramenpädagogischen Literaturvermittlung einen äußerst vielversprechenden Ansatz, um der akuten Krise in den deutschen Literaturseminaren effektiv entgegenzuwirken.
Ein Grund für diese Annahme ist sicherlich, dass dieser Ansatz weitgehend den veränderten Rezeptionsgewohnheiten des 21. Jahrhunderts Rechnung trägt. In einer Welt, in der die Macht des Bildes herrscht und sich die simultan-multiple Form der Wahrnehmung gegenüber der linear-sukzessiven durchzusetzen scheint (Schewe/Scott 2003: 5758, Lehmann 2001: 11), muss es Studenten als lohnend erscheinen, Inhalte aus einem Medium der linear-sukzessiven Wahrnehmung in ein Medium der simultan-multiplen Wahrnehmung zu übersetzen.
Das größte Potential für die Literaturdidaktik stellen aber sicherlich die besonderen Bedingungen dramenpädagogischer Literaturrezeption dar:
Dramatisch interpretierte Literatur ist nichts weniger als belebte Literatur,“literature come to life” (studentischer Kommentar in: Schewe /Scott 2003: 71), denn der Inszenierungsprozess ist ja nichts anderes als die leibhaftige Verkörperung unserer literarischen Rezeption.
Wie Wagner (1998: 83) und Benton (1979) betrachten Schewe/Scott (2003: 69) den Leser als Darsteller, der sich eine geistige Bühne baue und sie mit Menschen, Szenen und Ereignissen aus dem literarischen Text fülle. Im dramenpädagogischen Literaturunterricht ist diese Bühne nun nicht mehr geistig-virtueller Natur, sondern sie ist konkrete Realität geworden. Die fiktionale Wirklichkeit der Literatur ist in die Lebenswirklichkeit der rezipierenden und gleichzeitig darstellenden Studenten eingedrungen.
Der studentische Leser eines deutschen Theaterkurses ist weiterhin ein genauer Leser, und er muss es sein, denn um eine literarische Figur überzeugend auf der Bühne interpretieren zu können, muss er sich ein gründliches Textverständnis erwerben. Die in der dramenpädagogischen Literatur oftmals beschriebenen “in role” Übungen [3] können hierbei die Reflexion der Figurenkonzeption wesentlich unterstützen.
Bei der Dramatisierung narrativer Texte können handlungsbeschreibende Textpassagen ganz konkret als dramatische Inszenierungsanweisungen gelesen werden. So wurde etwa die gesamte Beschreibung von Mozarts Orangenfrevel aus Mörikes Novelle “Mozart auf der Reise nach Prag” intakt und ungekürzt als konkrete Handlungsanweisung für den darstellenden Studenten in der dramatisierten Fassung beibehalten. Auf diese Weise ist auch ein Höchstmaß an Authentizität in der Darstellung garantiert.
Mörikes Text wie auch Canettis Texte aus “Ohrenzeuge” sind nun Texte, denen in einem konventionellen akademischen Literaturkurs innerhalb eines “undergraduate programme” auf Grund ihrer sprachlichen Komplexität und ihrer Distanz vom studentischen Erfahrungshorizont mit größter Wahrscheinlichkeit wenig Erfolg beschieden wäre.“Dramatisch” anders liegt die Sache, werden diese Texte inszeniert.
Repliken wie die des Grafen in “Mozart auf der Reise nach Prag”: “Das wär ja höllenmäßig! Das geht ja über alle Begriffe! Ein Wiener Musikus, sagt Ihr?” oder Mozarts Beschreibung des Gärtners “Der Satan, der! Ein Gesicht wie aus Erz …, dem grausamen römischen Kaiser Tiberius ähnlich”, die bei einem fremdsprachlichen Leser bei individueller und isolierter Rezeption wohl eher Befremden als Entzücken auslösen, werden in der gemeinsamen Inszenierungsarbeit zu Wortmaterial, mit dem beliebig gespielt und experimentiert werden kann, bis der erwünschte Ausdruck sich einstellt – und die damit tief ins (Unter)bewusstsein der Rezipienten eindringen können.
Durch diesen Prozess der RezeptionsIntensivierung entfaltet sich auch bei äußerst “spröden” literarischen Texten die eigenartig anziehende Ästhetik des dramatisch gesprochenen Wortes.
Und könnten Canettis Charaktermetaphern, die Figuren eines “Heimbeißers” oder einer “Sultansüchtigen”, lustvoller in ihrer Tiefsinnigkeit erfasst werden als in einem dramatischen “Wörtlichnehmen” auf der sinnlich-konkreten Rezeptionsebene?
Fremdkultur am eigenen Leib darstellen
Will man den Geschmack eines fremdkulturellen Gerichtes erforschen, so muss man es kosten, man kann sich nicht zufrieden geben, das Rezept auf das Genaueste zu lesen.
Am eindrücklichsten wird Fremdkultur nämlich am eigenen Leib erfahrbar. Eine Rolle in einem Theaterstück aus der deutschsprachigen Welt zu übernehmen, bedeutet für einen kanadischen Studenten, aus der Position einer kulturellen Außenperspektive in die Position der zielkulturellen Innenperspektive wechseln zu müssen, denn die dramatische Figur ist ja in dieser Zielkultur verankert. Die Studenten müssen sich also intensiv mit den kulturellen Implikationen ihrer Rolle auseinandersetzen. Der reine Wechsel der Sprachkodes konstitutiert ja noch nicht eine Figur aus der deutschsprachigen Welt, das gesamte nonverbale dramatische Repertoire, Mimik, Gestik, Bewegungsmodus, sind kulturabhängig und müssen überzeugend imitiert werden.
Die Darstellerin der “Sultansüchtigen” sah sich allerdings mit einer doppelten Herausforderung konfrontiert: Wie interpretiert eine kanadische Studentin eine österreichische Dame, die vorgibt, eine türkische Haremsdame zu sein?
Von erstaunlicher Vielfalt sind die Möglichkeiten, Ausdrucksformen der Zielkultur in einem Theaterkurs zu vermitteln, sei es nun in körperbezogenen, die Aufführung vorbereitenden dramenpädagogischen Übungen oder in der theoretischen Erarbeitung des kulturellen Kontextes und Hintergrundes des inszenierten Textes.
So vertieften wir uns für die beiden Theaterprojekte in folgende “fremdkultur”-erforschenden Aktivitäten:
Für den “Ohrenzeugen”: Unter großem Gelächter (wohl ein sicherer Indikator für die Befremdlichkeit der Aktivität und damit der großen kulturellen Distanz zur modernen kanadischen Alltagskultur) wurde in einem dramenpädagogischen Spiel eine förmliche Vorstellung mit anschließendem (möglichst elegantem) Handkuss eingeübt. Alle Studenten wurden von einem professionellen Tanzlehrer im Wiener-Walzer-Tanzen unterrichtet, und die “Sultansüchtige” und alle anderen Interessierten erhielten zwei Bauchtanzstunden. Der westliche Blick auf die türkische Kultur aus der kulturellen Außenperspektive wurde demonstriert an der türkischen Mode des 18. Jahrhunderts (mit Beispielen von Porträts türkisch gekleideter Damen der westlichen Adelsgesellschaft und Mozarts “Entführung aus dem Serail”) und an den schwülen Haremsphantasien der französischen und deutschen Maler des 19. Jahrhunderts, die der türkischen Lebenswirklichkeit dieser Zeit so völlig entrückt sind.
Die 30er Jahre wurden durch kulturelle Ausdrucksformen der Epoche rekonstruiert: der politische Witz als Spiegel des bedrückenden politischen Klimas, populäre Musik (besonders jüdische Künstler aus Wien wie Hermann Leopoldi und Fritzi Massary), Mode und Frisuren (Bubikopf, Wellenreiter).
Für “Wer war Mozart?”: Die Einstudierung eines Menuetts aus dem 18. Jahrhundert (Mozarts berühmtes Maskenduett aus “Don Giovanni”) ließ uns die Erkenntnis gewinnen, dass Tanzschritte, Figuren und Bewegungen dieser Epoche stark durch die Besonderheiten des Kostüms konditioniert waren, so der “Zeig-die-Schuhschnalle”-Schritt und die typische Hebung des Ellenbogens (um den spitzenverzierten Ärmel der Dame zurückfallen zu lassen und ihren Arm graziös zu entblößen). In der Szene, in der Mozart und seine Frau Abschied nehmen von ihren neugewonnenen adeligen Freunden, stießen wir auf die entscheidende Frage, ob denn in diesem Fall eine Umarmung oder sogar ein Kuss angemessen wäre. Die Antwort des konsultierten 18. Jahrhundert-Spezialisten war ein klares Nein: die allen auferlegte Förmlichkeit sei zu groß gewesen, um Intimitäten dieser Art zuzulassen. Durch diese Episode aus der Probenzeit ist uns allen klar geworden, welch erstaunlicher, leibhaftiger kultureller Erkenntnisgewinn im Rahmen eines Theaterprojektes überhaupt möglich ist. In unserem Falle: Der gesamte Verhaltenskodex des 18. Jahrhunderts.
Ästhetik, Kunst und Kreativität
Ein Theaterstück zur Aufführung zu bringen ist eine künstlerische Aktivität. “Unterricht als sinnliche Gestaltung”, “Argumente für ein Ernst(er)nehmen künstlerischer Orientierung in der Pädagogik”, “Drama als pädagogische Kunstform” (Schewe 1993: 61-79), “Drama as an art form” (Fleming 2004: 120) – so und ähnlich lesen sich die Stichwörter in der Literatur zur Dramenpädagogik.
Schiller beschreibt in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung die Ausbildung des Empfindungsvermögens als ein dringendes Bedürfnis in einer rationalen Kultur.
Die Gegensätze zwischen Sinnlichkeit (Natur) und Vernunft müssten ausgeglichen werden – der Weg “zu dem Kopf durch das Herz” müsse geöffnet werden (8. Brief).
Die Vermittlung zwischen Sinnlichkeit und Vernunft geschehe durch den Spieltrieb, der den Menschen erst ganz Mensch sein lasse. Der Gegenstand des sinnlichen Triebes, das Leben, verbinde sich mit dem Gegenstand des Formtriebes, der Gestalt: Gegenstand des Spieltriebes sei also die “lebende Gestalt” – was man in weitester Bedeutung Schönheit nenne (15. Brief).
Auch Theaterspielen bedeutet ja auf vielfältige Weise lebende Gestalt schaffen.
Mit ihrer Kreativität und ihrem ästhetischen Empfinden haben die Kursteilnehmer entscheidend zu beiden Inszenierungen beigetragen.
So wurde von den Studenten für die Figur des Ohrenzeugens ein Paar überdimensionaler roter Ohren gebastelt (auf den Kopf zu setzen wie Ohrenschützer), “Kindskopf” Mozart wurde vom Bäsle durch eine von einer Studentin in eigener Initiative schnell herbeigeschaffte, dramatisch sehr wirkungsvolle Photographen-Leinwand getrennt und zum ironisierten Abschied Mozarts von den Freunden wurden riesige spitzenbesetzte Taschentücher aufgetrieben.
Zur dramatischen Gestaltung der Canetti-Figuren hatten alle Kursteilnehmer einen Pool von Ideen für das dramatische Skript angelegt. Die Mitglieder einer spezifischen Skriptgruppe trafen sich dann regelmäßig mit der Dozentin, wählten die besten Skriptideen aus und schufen damit die Grundlage für die dramatischen Dialoge, die an passender Stelle in die narrativen Canetti-Texte eingeschoben wurden.
Nicht nur das Publikum versetzten die oft ungeahnten darstellerischen Talente der Studenten in Erstaunen, Talente, die zuweilen nur ein wenig eines Anstoßes und einer “Starthilfe” bedurften, um zur Entfaltung zu kommen.
Eine Choreographiegruppe entwickelte eigenständig eine Choreographie zu Falcos Song “Rock me Amadeus”, die “Mannsprächtige” stellte ihr stimmliches Talent mit dem Schlager “Man muss den Männern was bieten” aus den 30er Jahren unter Beweis, und die Darsteller von Mozart und Eugenie aus Mörikes “Mozart auf der Reise nach Prag”, zwei Gesangsstudenten im letzten Jahr ihrer klassischen Gesangsausbildung, präsentierten in harmonischer Abstimmung auf ihre dramatischen Rollen Arien aus Mozarts “Don Giovanni” (Don Ottavio Donna Anna), sowie zwei Arien aus der “Zauberflöte” und “Cosí fan tutte”.
Des Pädagogen Genussmoment: Lernerautonomie in der Aufführungspraxis
Die Stichwörter “Lernerautonomie” und “projektbezogenes Lernen” haben sich in den letzten Jahrzehnten in der pädagogischen Diskussion großer Beliebtheit erfreut.
Für den deutschen Theaterkurs sind sie tatsächlich Realität geworden, denn ohne den größten lernerautonomen Einsatz in den aufführungsvorbereitenden Arbeitsgruppen und in den von der Dozentin völlig unabhängig operierenden Kleingruppen bei der Probenarbeit wären die Inszenierungsprojekte überhaupt nicht durchführbar gewesen.
Ein Höchstmaß an pädagogischem Nutzen erbringen sicherlich Theaterprojekte, in denen Studentenregisseure zum Einsatz kommen und die künstlerische Gestaltung (etwa Bühnenbild, Musik) weitgehend in die Hände der Studenten gelegt wird, wie das in den “Those Crazy Germans”-Theaterprojekten der deutschen Sektion der University of Guelph geschieht.
Von großer Wichtigkeit ist es in jedem Fall während der Inszenierungsarbeit an den Punkt zu gelangen, an dem die darstellenden Studenten das Projekt aus eigener Initiative vorantreiben und es als das ihrige betrachten und nicht als einen Fremdkörper, der ihnen von außen zwangsweise übergestülpt worden ist.
Eine spielerische Identifikation mit der Rolle, die ich doch aller Kontroversen zum Trotz (Stanislavsky-Brecht) als begrüßenswert bewerten möchte, ist oft ein Anzeichen dafür, dass dieser kritische Punkt erreicht wurde. Zwei Wochen vor der Premiere hatte sich die Darstellerin der Constanze aus Peter Shaffers “Amadeus”, viele Jahre lang eine “sensationelle Blondine”, über Nacht in eine „sensationelle Schwarzhaarige” verwandelt, nachdem sie historische Porträts einer Constanze Weber im Unterricht gesehen hatte. Und die E-Mails des Mozart-Darstellers in Mörikes “Mozart auf der Reise nach Prag”, wurden plötzlich mit “… aka Mozart” unterschrieben.
Je selbständiger und unabhängiger die darstellenden Studenten ihre Inszenierung in der Probephase vorbereiten, desto leichter wird es ihnen fallen, ihr Kunstwerk ganz alleine und ohne jeden Eingriff des Pädagogen der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Des Pädagogen Genussmoment ist gekommen, wenn sich der Vorhang zur Premiere hebt: Das Produkt seiner Arbeit in Ruhe (trotz aller potentiellen “Katastrophen”) und bar jeder Versuchung zum “Eingreifen” betrachten zu können.
Was bleibt, bleibt für Pädagogen und Studenten gleichermaßen: die Erinnerung an eine außerordentliche, vom eigenen künstlerischen Willen geprägte, persönlichkeitserweiternde Lebenserfahrung.
ANMERKUNGEN
[1] Als besonders nützlich erwiesen sich hier folgende dramapädagogischen Werke: Agosto Boal (1992), Games for Actors and Nonactors. London. Maria C. Novelly (1985), Theatre Games for Young Performers. Improvisations & Exercises for Developing Acting Skills. Colorado Springs. Anna Scher (1975), 100+ Ideas for Drama. London. Dies. (1987), Another 100+ Ideas for Drama. London. Ruth Zaporah (1995), Action Theatre. The Improvisation of Presence. Berkeley, California 1995.
[2] Für die “Wer war Mozart?”- Produktion haben uns freundlicherweise das deutsche Generalkonsulat Toronto und das Austrian Cultural Forum großzügig unterstützt.
[3] Siehe: Elektra I. Tselikas (1999), Dramapädagogik im Sprachunterricht. Zürich, 175-179 und zur Technik des “hot seating”: Ruth Huber (2004), "Persönlichkeit als Ressource: Rollenaushandlung und Gruppendynamik in theaterpädagogischen Prozessen," German as a Foreign Language (GFL) 1/2004, 58 und 65-66.
BIBLIOGRAPHIE
Aussprache
Duden. Aussprachewörterbuch (2000) Duden Band 6. Mannheim.
Moulton, William G. (1962). The Sounds of English and German. Chicago.
Phonetik Simsalabim (1998). Übungskurs für Deutschlernende. Von Ursula Hirschfeld und Kerstin Reineke, Berlin und München.
Siebs: Deutsche Aussprache (2000) Reine und gemäßigte Hochlautung. Hg.von Helmut de Boor, Hugo Moser und Christian Winkler, Wiesbaden.
Dramenpädagogische Spiele und Übungen
Boal, Agosto (1992). Games for Actors and Non-actors. London.
Novelly, Maria C. (1985). Theatre Games for Young Performers. Improvisations & Exercises for Developing Acting Skills. Colorado Springs.
Scher, Anna (1975). 100+ Ideas for Drama. London. Dies.: (1987) Another 100+ Ideas for Drama. London.
Zaporah, Ruth (1995). Action Theatre. The Improvisation of Presence. Berkley, California.
Theorie
Benton, Michael (1979). Children's Responses to Stories. Literature in Education 10 (2), 6885.
Boal, Augusto (1985). Theatre of the Oppressed, New York.
Bolton, Gavin (1979) .Towards a Theory of Drama in Education, Harlow.
Fleming, Michael (2004). Drama and Intercultural Education. German as a Foreign Language (GFL) 1/2004, 110-123.
Galli, Johannes (2001). Intercultural Communication and Body Language. Seattle.
Huber, Ruth (2004). Persönlichkeit als Ressource: Rollenaushandlung und Gruppendynamik in theaterpädagogischen Prozessen. German as a Foreign Language (GFL) 1/2004, 52-71.
Jung, Udo O.H. (2004). The Muses’ Itinerary: Drama in Foreign Language Teaching. A Bibliography. German as a Foreign Language (GFL) 1/04, 134-146.
Koerner, Morgan (2004). Comic Metatheater and Language Learning: Performing Ludwig Tieck’s ‘Der gestiefelte Kater’. German as a Foreign Language (GFL) 1/2004, 73-83.
Lehmann, HansThies (2001). Postdramatisches Theater. Frankfurt
Oelschläger, Birgit (2004). Szenisches Spiel im Unterricht ‘Deutsch als Fremdsprache’. German as a Foreign Language (GFL) 1/2004, 24-34.
Schewe, Manfred (Hg.) (1990). Drama und Theater in der Schule und für die Schule. Beiträge zur Einführung in die britische Drama und Theaterpädagogik. Universität Oldenburg, Zentrum für pädagogische Berufspraxis, 1990 (Heft 111/90).
Ders. (1993). Fremdsprachen inszenieren. Zur Fundierung einer dramapädagogischen Lehr und Lernpraxis. Oldenburg.
Ders. (2002). Lehren und Lernen mit Kopf, Herz, Hand und Fuß. Fremdsprache für die Praxis des Deutschunterrichts, Sondernummer 1993 II (Goethe-Institute Publication), 45-52.
Ders. (2002). Tapping the students' kinesthetic intelligence. In: Gert Bräuer (ed.): Body and language: Intercultural Learning through Drama. Westport, Connecticut/ London, 73-93.
Ders./ Scott,Trina (2002). Literatur verstehen und inszenieren. Foreign language Literature through Drama. A Research Project. German as a Foreign Language (GFL) 3 /2003, 56-83.
Tselikas, Elektra I. (1999). Dramapädagogik im Sprachunterricht, Zürich.
Turecek, Egon (2000). The use of drama activities for the teaching of young learners, Deutsch Lehren und Lernen, 22/2000, 26 (Association of Language Learning, Rubgy, U.K.).
Wagner, Betty Jane (1998). Educational Drama and Language Arts..What research shows. Portsmouth/NH.
Textausgaben
Schiller, Friedrich (2000). Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen. Mit den Augustenburger Briefen herausgegeben von Klaus L. Berghahn. Stuttgart: Reclam.
Die Muttersprache als Sprach-Mutter: ein Gegenentwurf zur herrschenden Theorie [1]
Wolfgang Butzkamm, Aachen
Whoever knows grammar in one language also knows it in another so far as its substance is concerned. (Anonym, 13. Jahrhundert, zit. bei Clark & Clark 1977)
Alles Lob, das man den alten Sprachen als Bildungsmitteln erteilt, fällt doppelt der Muttersprache anheim, welche noch richtiger die Sprach-Mutter hieße; und jede neue wird nur durch Verhältnis und Ausgleichung mit der ersten verstanden... (Jean Paul Friedrich Richter, 1806)
In der Muttersprache und durch sie haben wir (1) denken gelernt, (2) kommunizieren gelernt und (3) eine grammatische Grundordnung intuitiv zu erfassen gelernt. Beim Fremdspracherwerb ist deshalb die Muttersprache unser größter Aktivposten. Diese Theorie stellte die herrschende Auffassung vom Kopf auf die Füße. Sie wird in zwölf Thesen ausgefaltet, begründet und in einen historischen Zusammenhang gestellt.
Vorgeschichte: Rote Karte für die Muttersprache
Seit der neusprachlichen Reform am Ausgang des 19. Jahrhunderts ist die Rolle der Muttersprache neben der Grammatik lange Zeit das meistdiskutierte methodische Problem. Heute enthalten die amtlichen Richtlinien in Deutschland und vielen anderen Ländern die Empfehlung, den Unterricht möglichst einsprachig zu planen und die Muttersprache nur hinzuziehen, wenn es besonders schwierig wird. Dies Zugeständnis wird bei der Behandlung schwieriger Grammatikprobleme besonders häufig gemacht. Das von Frankreich mit dem staatlich geförderten audiovisuellen Kurs "Voix et images de France" ausgehende Zwischenspiel einer absoluten Einsprachigkeit war nur von kurzer Dauer. Insgesamt hat man sich hierzulande auf eine flexibel zu handhabende, pragmatisch verstandene Einsprachigkeit mit Abstrichen geeinigt, die aber keine eigentlichen zweisprachigen Übungsformen kennt. Lange Zeit, so heißt es, habe man noch nicht über die audiovisuellen Materialien für einen einsprachigen Unterricht verfügt. Inzwischen sind die da, die Bilder, Illustrationen, Grafiken, Transparentfolien, und die Lehrer sind entsprechend ausgebildet. Die Schlacht ist geschlagen. Der Siegeszug des so genannten direkten Prinzips scheint, jetzt auch unter dem neuen Banner eines kommunikativen Ansatzes, erfolgreich zu Ende geführt.
Spielverderber: (1) Widerspenstige Lehrer und Selbstbeobachtungen von Lernern
Wäre da nicht ein kleines, aber ständig fließendes Rinnsal von Arbeiten, in denen widerspenstige Lehrer gegen die herrschende Ideologie anschreiben und ihre zweisprachigen Techniken beschreiben: reflektierte Praxis oft ohne theoretischen Anspruch und wohl auch ohne weitergehende Kenntnis der langen Geschichte dieses Themas. Bis auf wenige Ausnahmen sind diese Arbeiten eher apologetisch im Ton. Man ist sich sehr wohl der Tatsache bewusst: “Every method that does not teach English via English has become ‚scientifically’ suspect.” (Ridjanovic 1983: 13). Das Thema Muttersprache sei für viele ein wohlbehütetes Familiengeheimnis, ein “skeleton in the cupboard...a taboo subject, a source of embarrassment,” so Prodromou (2002: 6). Immer wieder ist von Schuldgefühlen die Rede, die man abschüttelten konnte, weil man die Lernwirksamkeit bestimmter zweisprachiger Techniken erfahren habe. Meist also mehr oder weniger schüchterne Legitimationsversuche, mehr oder weniger behutsame Formulierungen.
Typisch der Fall eines französischen Germanisten. Er erteilt als Emeritus Nachbarskindern kostenlosen Nachhilfeunterricht und berichtet darüber:
La
méthodologie en vigueur
se révélait
inadaptée aux problèmes de certains élèves.
En ce qui me concerne, j’ai cru de
mon devoir de corriger les erreurs du livre et/ou de la méthode.
Par erreur,
j’entends moins un point de détail que le
refus systématique du français en dehors de
l’explication
grammaticale. Victor, comme Kemal, ne comprenait pas grand’
chose aux images du manuel et de ce fait l’intelligence
des textes,
malgré les explications complémentaires du professeur,
était plus que floue.
J’ai donc demandé systématiquement la traduction
des passages étudiés et je me suis vite
rendu compte des nonsens et fauxsens. De même,
j’ai
demandé à mes trois protégés de me
réciter le vocabulaire
nouveau de l’allemand au français et du français
à l’allemand...
L’intérêt supérieur de l’enfant
m’a paru prévaloir sur
les préceptes et les tabous de la méthodologie
officielle.
Les résultats m’ont donné raison» (Bertrand
1999:
303f.).
Er macht das Gegenteil von dem, was die oberste Schulbehörde in Paris offiziell vorschreibt, im Interesse seiner Schüler – und sieht sich bestätigt.Aber er lässt es dabei bewenden. Die theoretische Signifikanz seiner Arbeitsergebnisse wird nicht weiter erörtert.
Oder nehmen wir den Fall einer Sprachdozentin an der Universität York, die mit ihren Italienischkursen, in denen regelmäßig 50 Teilnehmer sitzen, alle begeistert: “She’s breaking every rule there is. She translates everything as she goes along, she mixes in a lot of grammar, she has students parroting phrases and answers.“ (TES 3/10/1975) Zu nennen wäre auch die Suggestopädie, die als „alternative Methode“ im Erwachsenenunterricht ihre Anhänger hat und Parallelübersetzungen (Lateralversionen) bei der Textdarbietung benutzt.
Gelegentlich setzt man sich auch energisch zur Wehr: “After experimenting with various methods and techniques for three years, I decided on a ‘bilingual’ technique for teaching both grammar and vocabulary. After using the technique for two years, I can say that it is the most efficient of all the techniques I have tried “ (Kukulka 1982: 42).
Wie ist es möglich? Kann denn beides richtig sein? Die Vermeidung, ja das Verbot der Muttersprache und ihr Gegenteil, der regelmäßige Gebrauch bei der Textdarbietung? Eigentlich nicht, und so werden die Erfolge entweder wegerklärt oder ignoriert. Dann sind eben nicht die zweisprachigen Lehrtechniken entscheidend, sondern etwa die zugleich energische und humorvolle Persönlichkeit der Dozentin aus York, die ihre Stunden minutiös vorbereitet; oder es ist das freundliche, mit Musik untermalte und anderen ästhetischen Elementen kunstvoll gestaltete suggestopädische Lernarrangement, nicht aber die mitgelieferte Übersetzung.
Dies sind nur wenige Proben aus einem reichhaltigen , über Jahrzehnte hinweg gesammelten Material. Nachdenklich stimmen auch die Selbstbeobachtungen von Sprachlernern. Stellvertretend für viele ähnliche Bemerkungen hier die meines russischen Dolmetschers bei einem Vortrag im Goethe-Institut Moskau (Oktober 2002): „Manchmal wollte ich die genaue russische Entsprechung für einen neuen Ausdruck wissen, aber mein Deutschlehrer setzte meist zu einer langen deutschen Erklärung an, die mich nur ablenkte. Ich wollte es genau wissen, um dann den neuen Ausdruck sofort richtig gebrauchen zu können.“ Das Zeugnis von Roger Brown (1973), dem wir die klassische amerikanische Monographie über den Mutterspracherwerb verdanken, ist besonders eindrucksvoll. Er berichtet im Vorwort (Brown 1973: 4ff) von sich als Japanisch-Lerner in einer Berlitz-Schule.
But the insistence on avoiding the first language sometimes seems to lead to a great waste of time and to problems children, for some reason, seem not to have. One long morning my teacher tried to put across three verbs, kinasu, yukinasu, and kaerimasu, with the aid of paper and pencil drawings of pathways and persons and loci, and by much moving of herself and of me – uncomprehendingly passive as a patient in a hospital. But I could not grasp the concepts. I feel Mr. Berlitz would have suffered no great dishonor if she had said to me that the concepts in question sometimes go by the names come; go, and return.
Es gibt also schon bei einfachsten Begriffen Schwierigkeiten, wenn sie völlig fremd klingen. Hochinteressant wird es, wenn gestandene Lehrer noch mal eine neue Sprache lernen und dabei feststellen, dass sie sich in dieser neuen Rolle genau das wünschen, was sie als Lehrer ihren Schülern verweigern. So notierte sich eine Englischlehrerin, als sie an einem Griechischkurs (modern Greek!) teilnimmt, u.a.: “I’m not satisfied with getting the gist, I want to understand every word.“ “Translating the text was good, lots of dictionary work.“ “I’m going to learn the dialogue by heart, translate it into Greek and then back into English.“ (McDonough 2001: 405). Sie sieht die Widersprüche zu ihrem eigenen Lehrerverhalten, stellt sie auch bei Kollegen fest, vermag sie aber nicht aufzuklären. Müssten da nicht die Alarmglocken schrillen?
Ja aber... kann man denn nicht mit eindrucksvollen Zeugnissen von gelungenem einsprachigen Unterricht dagegen halten? Gewiss gibt es geschickt eingefädelte einsprachige Texteinführungen, ich habe selber in frühen Jahren auf dem Gymnasium Spaß dran gehabt und habe solche positiven (wie aber auch negativen!) Zeugnisse zur Einsprachigkeit in Aufsätzen vorliegen, in denen meine Studenten über ihre Schulzeit berichten. Bezeichnenderweise (?) habe ich die positiven Einschätzungen nur aus dem Englischunterricht, nicht aus dem Französischen als zweite Fremdsprache. Man täuscht sich auch oft darüber, wie diese Erfolge zustande kommen. Von vielen interessierten Schülern weiß man, dass sie eine solche Lektion präparieren, indem sie vorher in die zweisprachigen Vokabelverzeichnisse schauen. Außerdem ist da noch ein wichtiger Unterschied: Die Befürworter zweisprachiger Techniken kennen auch die traditionelle Einsprachigkeit und praktizieren sie, wenn die Umstände es erfordern. Dass ihrerseits die Verfechter der Einsprachigkeit auch ausgefeilte zweisprachige Techniken aus eigener Anschauung kennen, wird aber nicht deutlich. Dass bei günstigen Verhältnissen mit entsprechenden Stützpraktiken einsprachiger Englischunterricht für Deutsche (!) relativ erfolgreich sein kann, steht also nicht zur Debatte. Meine Theorie besagt, dass mit Beihilfe bilingualer Techniken bessere Erfolge erzielt werden können. Sie besagt auch, dass diese Mithilfe bei aus unserer Sicht „schwierigen“ Sprachen viel stärker ins Gewicht fällt. Ich stelle ein allgemeines Sprachlerngesetz auf, das den Fremdsprachenunterricht weltweit, nicht bloß Englischunterricht für Deutsche betrifft.
Spielverderber: (2) Unterrichtsforschung
Das Einsprachigkeitspostulat kann diese Dissonanzen nicht auflösen. 1967 erschien eine bahnbrechende Arbeit, C.J. Dodsons Language teaching and the bilingual method. Hier wurde eine neue zweisprachige Methode auf der Basis von mehreren kontrollierten Unterrichtsexperimenten konzipiert, ein Frontalangriff auf das Muttersprachenverbot: “...drastic rethinking for language-teaching methods is called for.“ (Dodson 1967: 16).
Was selten ist: Andere Forscher aus unterschiedlichen Ländern ließen sich davon anregen und haben versucht, entweder Dodsons Experimente direkt zu replizieren oder ähnlich gelagerte Methodenvergleiche durchzuführen: Immer waren die zweisprachigen den einsprachigen Techniken überlegen (Sastri 1970; Walatara 1973; Meijer 1974; Ishii et al. 1979). Später wurde Dodsons Arbeit noch einmal von Butzkamm (1980), Kaczmarski (1988) und Caldwell (1990) ausführlich gewürdigt. Auch Kasjans (1995, 1996) Machbarkeitsstudien im Bereich Deutsch für Japaner beziehen sich ausdrücklich auf Dodson.
Man muss sich vor Augen halten,
dass demgegenüber kaum ein
Aspekt des modernen kommunikativen Ansatzes in vergleichenden
Methodenexperimenten überprüft wurde.
Was Richards (1984: 19) monierte, gilt heute noch:
“No studies
have been
undertaken by those promoting this view to demonstrate that
classrooms in which learners are encouraged to use the target
language for problem solving, communicative tasks,
information exchange,
and meaningful interaction are indeed more conducive to successful
language learning than classrooms in which
the teacher dominates much of the teaching time and where the
primary focus of activities is on more controlled and less creative
uses of language.”
Handlungsorientierung oder task-based instruction (TBI) ist zweifellos “in”, aber “concrete evidence of language learning in TBI, in the sense of progressing from not knowing (how to do) something to some degree of knowing, is almost non-existent, to my knowledge“ (Bruton 2003: 6).
Die Beharrlichkeit des Dogmas und die anglo-amerikanische Dominanz
Die Fachwelt insgesamt aber reagierte skeptisch. Am Ende fand sie es bequemer, das Ganze zu vergessen. Ich selbst habe die außerordentlich gut gemachte, fast vierhundert Seiten starke niederländische Studie von Meijer, der eine englische Zusammenfassung beigegeben war, nie zitiert gesehen. Wenn man heute in Arbeiten schaut, die einen Überblick über methodische Ansätze geben, taucht die bilinguale Methode überhaupt nicht mehr auf. Die von Dodson angestrebte umfassende Revision des Einsprachigkeitspostulats hat sich nicht durchgesetzt – trotz seriöser empirischer Begründung. Konzessionen werden gemacht, aber ein Sichtwechsel hat nicht stattgefunden.
Der anglo-amerikanische Mainstream ist einfach darüber hinweg gerollt. Viele junge Muttersprachler aus anglophonen Ländern schwärmen in die Welt aus und finden ihr Auskommen, indem sie Englisch unterrichten – James Joyce und Samuel Beckett unter ihnen.Viele unterrichten ihre eigene Sprache – zumindest am Anfang – ohne jeden Bezug zur Kultur und Sprache ihrer Schüler. Berühmte Ausnahmen sind die „Großen“ unseres Fachs: Harold Palmer in Japan, Michael West in Indien oder auch Anthony Burgess in Malaysia. “One cannot but suspect that this theory of rigid avoidance of the mother tongue may be in part motivated by the fact that the teacher of English does perhaps not know the learner’s mother-tongue,” meint West (1962: 48). Neuerdings wird diese „English-only“ Politik als „neokolonialistisch“ eingestuft (Auerbach 1993: 13). Die beiden „neokolonialistischen“ Thesen, die anglo-amerikanischen Verlagen und Muttersprachlern die Vorherrschaft sichern, lauten: “English is best taught monolingually“ und: “The ideal speaker of English is a native speaker“ (Auerbach 1993: 14). Auch in deutschen Schulen kann ja die Fremdsprachigkeit des Unterrichts gelegentlich zum Mittel der Unterwerfung missbraucht werden, um aufmüpfige Schüler mundtot zu machen. Die internationale Dominanz englischer Muttersprachler, denen das Einsprachigkeitsdogma die Absolution erteilt, wenn sie die Sprache ihrer Schüler nicht können, plus die billigere Massenproduktion rein englischsprachiger Lehrwerke aus dem anglo-amerikanischen Mutterland sind wohl gewichtige Gründe für die Festschreibung der Forderung nach der Einsprachigkeit des Unterrichts. [2]
Die Dominanz dieser Richtung hat
natürlich noch andere
Gründe:
Ein Deutscher zitiert selten einen schwedischen Aufsatz
und ganz selten einen japanischen. Aber ob deutsche,
schwedische oder japanische Fremdsprachendidaktiker:
Sie alle zitieren englischsprachige Literatur,
die dadurch ein unverdientes Übergewicht bekommt.
Es wird viel zu wenig beachtet, wie sehr
die allgemeine angloamerikanische Hegemonie auch sprachlich
bedingt ist. Wir
haben eine völlig neue Situation der
Ungleichheit:
Das klassische Latein der Gelehrten Europas dagegen war für alle
seine Benutzer eine Zweit- oder Fremdsprache,
auch für die Romanen. [3]
Der Gegenentwurf: Die Muttersprache als Bezugsbasis
Ich lege eine Theorie vor, die der Muttersprache die ihr zustehende Rolle als Bezugsbasis der Fremdsprachen zuweist. Zugleich wären 2000 Jahre dokumentierter Fremdsprachenlehre und europäischer Bildungstradition, in denen die Muttersprache diesen Platz innehatte, rehabilitiert. Die Muttersprache ist bei allen Schulfächern, auch dem Fremdsprachenunterricht, der stärkste Verbündete des Kindes und ist darum systematisch zu nutzen. Dagegen steht das vom didaktischen Mainstream betonte negative Bild: Der Fremdsprachenlehrer baut Inseln, die ständig in Gefahr sind, vom Meer der Muttersprache überspült zu werden. Man muss sie zurückdrängen, Dämme gegen sie aufrichten, auf ein Minimum beschränken.
Richtig daran ist: Jede neue Sprache trifft auf die schon vorhandene Muttersprache. Alle Sprachen sind aber insofern Konkurrenten, als ohne Kontaktzeit Sprachverlust droht und die Gesamtkontaktzeit nicht erweiterbar ist. Weil nun die Muttersprache immer schon da ist, lässt es sich so leicht aus der Fremdsprache flüchten – eine ständige Versuchung für Schüler und Lehrer. Im Unterricht aber muss der Schüler in die Fremdsprache eintauchen können. Man lernt keine fremde Sprache, indem man eine andere gebraucht. Es ist dieser Anteil des Wahren im Falschen, von dem man sich täuschen lässt.
Falsch ist nämlich, dass man die Muttersprache am besten nur in Ausnahmefällen zu Hilfe nehmen soll. Ich setze dagegen folgende Theorie:
In der Muttersprache und durch sie haben wir (1) denken gelernt, (2) kommunizieren gelernt und (3) eine grammatische Grundordnung intuitiv zu erfassen gelernt. Dabei stößt die Muttersprache nicht nur das Tor zur eigenen Grammatik, sondern zu allen Grammatiken auf, insofern sie das in uns schlummernde universalgrammatische Potential aktiviert. Zugleich ist unsere (4) Gefühlswelt muttersprachlich durchtönt. Dieses Geprägt- und Schon-Informiertsein, d.h. die umgreifende, in der Erstsprache heranreifende Sprachlichkeit des Menschen, ist das Fundament unserer Selbstwerdung und der größte Aktivposten des Fremdsprachenlerners. Die Muttersprache ist darum das Instrument zur Erschließung fremder Sprachen, ihrer Bedeutungen, ihrer grammatischen Formen und Funktionen, der Dechiffrierschlüssel, der den schnellsten, den sichersten, den genauesten und vollständigsten Zugang zur Fremdsprache bildet – solange bis diese sich selbst weiterbauen kann.
Die Theorie im Einzelnen
Diese Theorie lässt sich in zwölf Thesen aufgliedern:
THESE 1. Einsprachiges Unterrichten ohne Zuhilfenahme der Muttersprache ist zwar äußerlich möglich, einsprachiges Lernen aber lange Zeit eine innere Unmöglichkeit.
THESE 2. Erklärungshilfen wie Abbildungen, Tafelzeichnungen und fremdsprachige Paraphrasen können den Unterricht bereichern, funktionieren aber auch als Stützpraktiken, die verschleiern, dass die Grundannahme, die Einsprachigkeit des Unterrichts, zu revidieren ist.
THESE 3. Die lexikalisch-grammatische Ausdünnung der Texte und damit ihre inhaltliche Anspruchslosigkeit ist eine direkte Folge des Prinzips der Einsprachigkeit, d.h. sie ist ebenfalls nur notwendig, um dieses Prinzip zu stützen.
THESE 4. Muttersprachliche Verstehenshilfen, die oft beiläufig und unauffällig erfolgen können, erlauben eine frühe Verwendung gehaltvoller authentischer Texte, die in den Lehrbüchern fehlen, weil sie nicht rein fremdsprachig zu vermitteln sind.
THESE 5. Muttersprachliche Verstehenshilfen, richtig eingesetzt, erleichtern die fremdsprachliche Unterrichtsführung, statt sie zu verhindern.
THESE 6. Muttersprachliche Verstehens und Ausdruckshilfen, richtig eingesetzt, ermöglichen mehr echte, nicht planbare gehaltvolle Kommunikation als ein Unterricht, der auf solche Hilfen verzichtet.
THESE 7. Idiomatische Übersetzungen können manche grammatischen Funktionen umstandslos klären und erlauben so einen weitgehenden Verzicht auf die grammatische Progression der Lehrtexte, was ebenfalls die Wahl authentischer Texte erleichtert.
THESE 8. Die gezielte Ausnutzung lexikalischer und syntaktischer Verwandtschaften zwischen der Muttersprache und den europäischen Schulfremdsprachen fördert das Behalten und vertieft das Verständnis der Geschichtlichkeit von Sprache und Kultur.
THESE 9. Störende muttersprachliche Interferenzen (”I become a beefsteak”,“Everbody needs today a computer“) können nie ganz vermieden, paradoxerweise aber gerade durch bilinguale Techniken verringert werden.
THESE 10. Ausgefeilte zweisprachige Unterweisungstechniken sind in der Schule so gut wie unbekannt.
THESE 11. Weniger flexible und sprachgewandte Lehrer ebenso wie lernschwache Schüler können das offiziell geforderte Prinzip der Einsprachigkeit nicht durchhalten, mit dem man es Schülern wie Lehrern unnötig schwer macht.
THESE 12. Jeder fremdsprachliche Zugewinn muss so tief Wurzel schlagen, dass er letztlich ohne Dazwischentreten der Muttersprache verfügbar wird.
Geltungsbereich
Diese Theorie soll gelten für Kinder ab sieben Jahren, d.h. ab einem Alter, in dem sich einerseits eine Muttersprache fest etabliert hat, andererseits bestimmte kindliche Sprachlernfähigkeiten schon zurückgebildet haben. Das Gehirn verzichtet gewissermaßen im Verlauf seiner Entwicklung auf Fähigkeiten, die nicht mehr universell nützlich sind. Umso mehr sind wir später darauf angewiesen, den Weg zur Fremdsprache über die Muttersprache zu nehmen. Ab diesem Alter beansprucht die Theorie auch Geltung für den Immersionsunterricht. Die positiven Auswirkungen gezielter muttersprachlicher Mithilfe sollten jedoch im Unterricht unter den üblichen zeitlichen Beschränkungen stärker ausfallen als unter den Bedingungen der Immersion.
Zu These 1
Niemand kann sein Vorwissen einfach
abschalten.
Für den
Anfänger postulieren wir eine ununterdrückbare
„stille”
Präsenz
der Muttersprache auch bei absoluter Einsprachigkeit des
Unterrichts. Jeder Sprachunterricht müsste scheitern,
wenn der
Schüler nicht diesen Anschluss an das Mächtigste in ihm immer
schon von selbst vollzöge.
Genauso wenig wie man auf unsere
an der Muttersprache ausgebildete Stimme oder die an und von
ihr geformte Schreibhand verzichten kann,
kann man das muttersprachlich geprägte Welt und
Sprachverständnis ausschalten.
Wenn die Muttersprache in der Fremdsprache nicht mitdenken
würde (bis diese sich allmählich verselbstständigt),
könnten die
Schüler überhaupt nicht mitdenken!
“Ignoring
or
forbidding
English will not do,
for learners inevitably engage in French-English associations and
formulations in their minds.
Since many
of these subvocal associations are evidently incorrect,
it is far
better to deal with cross-linguistic influences overtly.”
(Hammerly 1989: 51)
Typisch, wie in einem rein fremdsprachlichen Kontext die Muttersprache durchbricht:
Pupil: Bob's
missing.
Teacher: Yes.The school bus is late because of the snow.
Pupil: Mike is nich missing.
John is nich missing.
Im Französischen sind auch Genusfehler wie »la mouvement« ein Indiz für die heimliche Präsenz der Muttersprache. Die Unvermeidbarkeit muttersprachlicher Assoziationen ist zumindest seit Aronstein (1926: 71) ein Standardargument, dass Lehrer immer wieder durch Beobachtungen aus dem eigenen Unterricht abstützen können. Jeder Lehrer setzt doch bei seinen Erklärungen von birthday oder postman schon voraus, dass seine Schüler wissen, was ein Geburtstag oder was die Post (in unserem Kulturkreis) ist. D.h. das Innewerden der Bedeutung schließt die Vernetzung mit der Muttersprache immer schon ein – bis die Fremdsprache selbst ein immer dichteres Netz geknüpft hat. Man halte sich vor Augen, wie viel Erlebtes vorangegangen ist, bis das Kind einen richtigen Begriff von „Geburtstag“ oder „Postboten“ hat.
Damit ist auch ein Gegenargument
entkräftet,
das man häufig hört:
Wenn die
Einwirkungen der
Muttersprache schon nicht
auszuschalten sind,
so sollte man sie durch zweisprachige
Vokabeleinführung und Vokabelverzeichnisse nicht auch noch
verstärken. Nur in solchen Fällen,
wo sich beim besten Willen
keine vertretbare Definition innerhalb des Vokabelschatzes der
Schüler finden lässt...nur in den ganz dringenden
Fällen...“ (Toth
1973: 12).
Hier werden „die Einwirkungen der Muttersprache“ zugegeben, aber es wird unterstellt: Wenn schon unvermeidlich, so doch unerwünscht. Unsere Theorie dagegen sagt: Die Mitwirkung ist nicht nur unvermeidlich, sondern notwendig. Deshalb machen wir sie auch explizit, präzisieren sie oder stellen sie richtig. Unklares und Ungenaues können sich erst gar nicht einnisten.
Über die grundlegenden muttersprachlichen Pionierleistungen, auf die jeder Unterricht wie selbstverständlich zurückgreift, vgl. Butzkamm (2002, Kapitel 1, passim).
Zu These 2
Im Vergleich zu muttersprachlichen Wort- und Satzäquivalenten handelt es sich um Kompensationen, die oft auch dann zu Missverständnissen führen, wo man sie nicht vermutet hätte. Sie können und dürfen die innere Anbindung an die muttersprachlich durchtränkte Erfahrungswelt nicht verhindern („Aha, anniversaire ist Geburtstag.“). Mehrfach wird von informellen Verstehensüberprüfungen nach einsprachiger Textdarbietung berichtet, zuletzt von Solmecke (2000: 319) und Schiffler (2002: 24). Stets wurden bei den Schülern viel mehr Missverständnisse aufgedeckt, als man erwartet hatte. Im Übrigen sind Visualisierungen in ihrer modernen Perfektionierung, besonders wo es um Landeskunde und bilingualen Sachfachunterricht geht, willkommene Hilfsmittel, während die Auswahl und Streckung von Grammatik und Wortschatz lediglich den Ausschluss der Muttersprache stützen, sonst aber nur schaden.
Bei vielen Wendungen schafft allein die muttersprachliche Klärung eine Sicherheit des Gefühls und Vertrauen zum fremdsprachlichen Ausdruck (“Can’t we do something else?“ „Können wir denn nicht mal was anderes machen?“ »Il faut te ressaisir«. „Du mußt dich einfach mal zusammenreißen“ »Tu suivras peutêtre sur le livre de Pierre?« „Könntest du vielleicht bei Pierre mit reinschauen ?“). Bei mündlichen Satzäquivalenten klären zusätzlich Stimme, Tonfall, Mimik und Gestik auf sehr überzeugende Weise, was und wie es gemeint ist, d.h. eben auch den pragmatischen Gehalt. Ich habe dabei den Eindruck, dass sich dabei die Sprachen plötzlich ganz nahe kommen, dass die fremde Sprache dem Schüler weniger fremd, ja irgendwie sympathischer wird (!).
Bei einsprachigen Erklärungen fühlt man sich auch bei fortgeschrittener Lektürearbeit oft im Stich gelassen. Man kann sie sich fast willkürlich herausgreifen: surly, rude and illmannered’ oder gambol‚ run about’ tart‚ sexually immoral woman’ usw. Was hier englisch erklärt wird, ahnt man aber schon aus dem Kontext. Alles Feinere, Konnotative, Gefühlsmäßige geht flöten. Warum hat nun der Autor genau diesen Ausdruck gewählt? Oft sagt einem das erst die gute Übersetzung, die wirklich zum Text passt: „mürrisch“, „verdrießlich“ oder „Freudensprünge machen“ und „Flittchen“. Und dann hat man die Textstelle viel besser verstanden. Einsprachige Worthilfen sind in dieser Situation oft nur ein schlechter Ersatz, eben Kompensationen.
Nebenbei sollten wir auch an Ausbau und Verfeinerung der Muttersprache denken.
Zu These 3
Weitgehende Einsprachigkeit ist am Anfang nur machbar, wenn die Texte entsprechend gestaltet und entlastet sind. Man mache die Umkehrprobe: Es ist undenkbar, wie früher Dickens’ Weihnachtsgeschichte oder das Johannesevangelium als Einführungstext ohne reichliche Mithilfe der Muttersprache zu verwenden. In der Tat wurden niveauvolle Texte der Einsprachigkeit geopfert (Butzkamm 2002: 171f.). Das geht bis in die Grammatik hinein. Sprachmeister früherer Jahrhunderte forderten in der Nachfolge Quintilians, als Beispielsätze Sentenzen, Sinnsprüche, geflügelte Worte usw. zu verwenden, die sich dem Gedächtnis dauerhaft einprägen können. Wo sind sie geblieben? Mein Lieblingsbeispiel fürs Adverb: Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely (Lord Acton); oder für den Konjunktiv: Quoi que tu fasses, gardetoi de haïr (R. Rolland).
Zu These 4
Genau solche Hilfen erfordern auch der Sachfachunterricht in der Fremdsprache und fächerübergreifende Projekte, die auf authentische Texte gar nicht verzichten können. „Viele landeskundlichen Inhalte, die für die Schüler zu bestimmten Augenblicken im Verlauf des Fremdsprachenunterrichts interessant wären, können bei einsprachig geführtem Unterricht nicht behandelt werden, weil die fremdsprachlichen Mittel der Schüler noch nicht ausreichen,“ urteilt Erdmenger (1982: 360), Autor einer Landeskunde-Didaktik. Damit fällt auch das Argument, das man mir oft entgegengehalten hat: „Wenn die Muttersprache zugegebenermaßen schon implizit mitwirkt, warum soll ich sie dann noch explizit verwenden. Es geht auch ohne.“ Ja, nur weil es die Stützpraktiken gibt, vor allem den Verzicht auf gute Texte. Mir schwebt da etwas ganz anderes vor. Immer wieder treffen wir auf tolle Texte und verzichten auf sie, weil sie Passagen enthalten, die uns zu lange aufhalten würden. Hier kann man zweisprachige Ausgaben passagenweise benutzen: Die Sprachen teilen sich die Arbeit. Statt schwierige oder auch weniger interessante Passagen einfach zu überspringen, überbrücken wir sie mit Hilfe von Übersetzungen, die wir den Schülern mitliefern. Gerade interessierte Schüler greifen oft zu diesem Hilfsmittel. Umgekehrt können wir den Schülern auch die fremdsprachige Wiederaufnahme privater Lieblingslektüre empfehlen.Warum soll man nicht Bücher, die man von sich aus noch einmal lesen will, nunmehr im fremdsprachigen Original lesen? Schüler lesen also ihr Lieblingsheft von Asterix oder Tintin jetzt auch auf Französisch und berichten eventuell in ein paar Sätzen vor der Klasse. Wo heute schon authentische Texte früh verwendet werden (meist als Zusatzstoffe wie etwa Yellow Submarine im zweiten Englischjahr), werden sie muttersprachlich erklärt. An dieser Stelle scheint es mir, als sei die Praxis der Theorie schon davon gelaufen. [4]
Banale, anspruchslose, papierdünne Texte ohne Bildungswert aber gefährden besonders den Unterricht der spät einsetzenden Fremdsprachen.
Zu These 5
Der Unterricht und was dort zu regeln ist, spielt sich natürlich grundsätzlich in der Fremdsprache ab. Damit ist eine wichtige und richtige Forderung der Direktmethodiker erfüllt, die Fremdsprache als unterrichtstragende, allgemeine Verkehrssprache zu etablieren. Aber: Gerade mit gezielten muttersprachlichen Hilfen ist es leichter, die Fremdsprache als Verkehrsprache im Unterricht konsequent zur Geltung zu bringen. Übungsanweisungen und Unvorhergesehenes werden beim ersten Mal – und nur dann – in einem schlichten Sandwich-Verfahren vermittelt: Lehrer: Tu as sauté une ligne. Du hast eine Zeile übersprungen.Tu as sauté une ligne. Am Ende der Stunde werden die neuen Ausdrücke gesammelt und aufgeschrieben.
Viele Kollegen haben erfahren, wie „energieverzehrend“ das Bemühen der Lehrer um einen einsprachigen Unterricht ist. „Da beißt man sich als Lehrer bei den meisten Schülern die Zähne aus,“ zitiert Appel (2000: 142) einen Lehrer. Der punktuelle, gezielte Einsatz der Muttersprache wird den „alltäglichen, langen, zähen Kampf“ der Lehrer (Appel 2000: 238) um Durchsetzung der Fremdsprachigkeit bei den Schülern wohl nicht ganz abschaffen, aber doch erheblich abmildern.
Zur Terminologie: Wir brauchen unmissverständliche Termini, und deshalb genügt mir auch nicht mehr die „aufgeklärte Einsprachigkeit“ als Terminus. Ein Unterricht, der die Muttersprache systematisch, wenn auch sehr diskret, mitverwendet, ist streng genommen nicht einsprachig. Ich spreche stattdessen von der „funktionalen Fremdsprachigkeit“ des Unterrichts.
Zu These 6
Die Schüler äußern sich spontan, riskieren mehr eigene Meinungen und erzählen Privates, die Lehrer können Aktuelles und Unvorhergesehenes zur Sprache bringen – eben weil knappe muttersprachliche Einhilfen das Gespräch in der Fremdsprache weiterbringen. Spontaneität, persönliches Engagement und ein gehaltvolles Unterrichtsgespräch gelten als zentrale Merkmale eines modernen kommunikativen Ansatzes. Die Verweigerung der Muttersprache aber kann Gefühle des Ungenügens und der Frustration nähren.
Ein Schnappschuss aus einer 5. Klasse des Inda-Gymnasiums Aachen (Aufnahme vom 9.7.02) zeigt, wie die Muttersprache mitwirkt und mitteilungsbezogenes Kommunizieren ermöglicht. Arno und Daniel haben gerade in Anlehnung an einen Basisdialog ein eigenes Stückchen verfasst und vorgespielt:
L:
Do you have any questions? ..
Questions for Arno and Daniel? .
. . Daniel,
do you like watching TV?
Daniel: Hmm, yeah.
L:
Yes? What do you watch?
Daniel: I watch football games/matches and ..
hmm Horror/Horror Filme.
L:
Horror films? Oh,
I don’t like horror films.
Do you like horror films?
Daniel: Hmm kommt ganz drauf an.
L:
It depends.
Daniel: Yes.
L:
And how many hours do you watch per day? ..
Do you watch TV every day?
Daniel: No.
L:
Not really? Only at the weekends?
Daniel: At the weekends I play with my friends.
L:
And when do you
watch TV?
Daniel: When no friend there is.
L:
When
there are no friends.
Daniel: Yes.
L:
Or when my friends are away.
Daniel: Yes.
L:
And how long do you watch? An hour or two hours,
three hours, five hours?
Daniel: What’s the meaning of
“hours”?
L: Ah, Stunde, sorry.
Daniel: No, I watch a half hours.
L:
Half an hour. Oh,
that’s not much.
Lizzy: Haven’t you not
friends in your city?
L:
Don’t you have friends?
Lizzy: Don’t you have friends
in your city?
Daniel: No,
die meisten sind zur Eifel gezogen.
L:
Most of them,
most of them
Daniel: Most of them
L: Most of them
Daniel: Most of them
L:
Have moved to the Eifel
Daniel: Have moved to the Eifel.
Momente echter Kommunikation, das zeigen unsere Unterrichtsanalysen immer wieder, sind durchsetzt mit muttersprachlichen Stückchen, die der Lehrer auffängt und fremdsprachlich zurückspielt – oder aber, sie finden auf dieser Klassenstufe überhaupt nicht statt. Da wundert sich ein German assistant an einer englischen Schule, warum die Eltern seiner Schüler alle die gleichen Berufe haben, und zwar nur X,Y, oder Z. Oder Praktikanten fällt auf, dass immer nur die gleichen Hobbys genannt werden. Das sind typische Belege für die ungewollten Nebenwirkungen der Einsprachigkeit, die die Kommunikation abschneiden: Schüler bleiben beim eingeführten Lehrbuchvokabular, ja werden noch dazu angehalten.
Zu These 7
Z. B. ist “Yesterday was Tuesday“ für einen Fünfjährigen genau so leicht zu verstehen wie “Today is Wednesday”, nicht jedoch für einen Zweijährigen mit seinem unentwickelten Zeitverständnis. Die Zurückhaltung bei der Einführung des past tense lässt die Pionierarbeit außer Acht, die die Muttersprache für die Fremdsprache geleistet hat. Desgleichen können deutsche Schüler schon in der ersten Unterrichtswoche mit englischen do-Konstruktionen, dem Gerundium oder auch dem gérondif problemlos fertig werden. Kein Warten mehr aufs Gerundium!
Wir können uns ohnehin nur deshalb in neue Grammatiken eingewöhnen, weil wir schon eine haben – die unserer Muttersprache. Schon als Jugendliche wären wir über die Zeit hinaus, in der es unserem Hirn möglich ist, eine Grammatik von Grund auf zu erwerben – wenn uns bis dahin Sprache vorenthalten worden wäre. (Ähnlich den Blinden, deren Augen nach einer Operation tadellose Bilder liefern, die aber dennoch nicht mehr richtig sehen lernen). Allein die Beachtung dieses Punktes könnte den Fremdsprachenunterricht weltweit revolutionieren!
Zu These 8
Die Verbindungen zwischen den Sprachen sollten ausdrücklich hergestellt und nicht unterdrückt werden etwa zwischen dictionary und diktieren, Diktat, Diktator, Diktatur oder zwischen history und historisch usw. Damit treiben wir als Fremdsprachenlehrer bewusst auch muttersprachliche Wortschatzarbeit. So machen wir auch wie selbstverständlich und eher unbewusst davon Gebrauch, dass die Sprachen, die wir vermitteln, Relativsätze ähnlich wie im Deutschen kennen – was ja längst nicht für alle Sprachen gilt. Also: „Interlingual vernetzend lernen und auf Bekanntes zurückgreifen“, auch und gerade auf muttersprachliches Vorwissen (Meißner 2000: 17). Vgl. für die romanischen Sprachen Klein & Stegmann (2000: 17): „Die konsequente Nutzung der Verwandtschaft oder Ähnlichkeit zwischen Sprachen ist ein bisher kaum genutztes Reservoir für einen leichteren Zugang zur Vielsprachigkeit.“
Zu These 9
Interferenzen sind unvermeidlich. »Tout bilingue a pu constater avec quelle facilité il fait des interférences même lorsqu’il essaie de les éviter à tout prix.» (Grosjean 1984: 28) Paradoxerweise kann man die Muttersprache am besten wegüben, indem man sie nicht ängstlich vermeidet, sondern richtig einsetzt. Manche faux amis (lexikalischer und grammatischer Art) bleiben ohne Kontrastierung mit der Muttersprache unerkannt. Im Nijverdal Experiment (Meijer 1974) konnte die Hypothese, dass der Einsatz zweisprachiger Techniken zu mehr muttersprachlich bedingten Interferenzfehlern führte, zurückgewiesen werden. Die Muttersprache bzw. eine muttersprachenähnliche Formulierung in der Fremdsprache ist gewissermaßen der Default-Fall, der automatisch eintritt, wenn unser Gedächtnis stumm bleibt und uns im Stich lässt. Die Sichtweise, die Muttersprache „sei schuld“, verhindert die tiefere Erkenntnis: Interferenz ist nichts anderes als Unkenntnis bzw. Noch-nicht-Können (James 1972: 36).
Zu These 10
Der Grund dafür: Die amtlichen Richtlinien fordern die Lehrer auf, die Muttersprache auf ein Mindestmaß zu beschränken. Generell ist sie nur als Ausweichmanöver für den Notfall anerkannt.
Mein Vorschlag zur Neufassung der Unterrichtslinien für den Fremdsprachenunterricht aller Schulformen:
Am Prinzip der Einsprachigkeit ist das richtig, was selbstverständlich ist: Die fremde Sprache lernt man nur, indem man sie auch benutzt. Nur der Unterricht kann erfolgreich sein, der sich zum allergrößten Teil in der Fremdsprache selbst abspielt. Gleichwohl gibt es effektive bilinguale Arbeitstechniken zum Aufbau der Unterrichtssprache, sowie bei der Wortschatz als auch bei der Grammatik und Textarbeit, auf die man nicht verzichten sollte. Sie sind auf klar definierte Übungsziele hin zu entwerfen und müssen stets in rein fremdsprachige Kommunikation einmünden. Richtig angewendet, fördern sie die funktionale Fremdsprachigkeit des Unterrichts, statt sie zu behindern. Die dosierte und wohlkalkulierte Mitwirkung der Muttersprache kann die Schüler früh zu authentischen Texten führen. Bilinguale kommunikationsvorbereitende Übungen können schnell und sicher zu ernstgemeinter, sachbezogener fremdsprachiger Kommunikation überleiten. Wo letztere ausbleibt, ist der Unterricht gescheitert – gleichviel ob sich der Lehrer um Einsprachigkeit bemüht oder bilinguale Arbeitsformen miteingesetzt hat.
Unsere These ist jedoch in einem bedeutsamen Punkte einzuschränken. Zwar sind ausgearbeitete zweisprachige Arbeitsformen unbekannt, aber führende deutsche Lehrwerke haben zweisprachige Grammatik und Vokabelteile. Hier hat die praktische Vernunft gesiegt und einen Teil des Problems entschärft. Mein Beitrag gibt dieser Praxis ein theoretisches Fundament. Ich meine allerdings weniger die muttersprachlichen Regeln und Erklärungen, die z.T. verzichtbar sind, sondern die unverzichtbaren sinngetreuen Übersetzungen der Beispielsätze. Wir lesen etwa in einer englischen Grammatik: „Zusammen mit dem Infinitiv des Perfekts steht needn’t mit Vergangenheitsbedeutung, um die Notwendigkeit einer bereits ausgeführten Handlung zu verneinen oder in Frage zu stellen.“ Ganz schön kompliziert, wenn wir’s nicht schon wüssten! Klar wird’s mit einem Beispiel, noch klarer, wenn das Beispiel in gutes Deutsch übertragen wird. Die Erklärung ist dann im Grunde überflüssig:
You needn’t have said anything.
Du hättest nichts sagen brauchen.
He needn’t have come.
Er hätte nicht kommen brauchen.
Wer wirklich erfahren will, was eine solche Übersetzung zu leisten vermag, muss es mit einer unbekannten Sprache tun. Ich empfehle, sich einmal die japanische Version von „Ich liebe dich“ anzuschauen!
Bedenken wir doch: „Kindern, aber auch manchem Erwachsenen fehlt die Fähigkeit zur tief dringenden Sprachanalyse. Aber wir können unsere analytische Schwäche mit Hilfe der Muttersprache überwinden.“ (Butzkamm & Butzkamm 1999: 309)
So wird in reichen Ländern des Westens mit eigenen Bildungstraditionen und starken Schulbuchverlagen das Schlimmste verhindert, nicht aber in armen Ländern oder auch in Ländern mit „kleinen“ Sprachen, in denen rein englischsprachige Lehrwerke verbreitet sind. Die in diesem Punkt vorzügliche deutsche Lehrbuch-Praxis bleibt aber ein theoretisch unaufgeklärter Kompromiss, zumal der weltweit agierende anglo-amerikanische English-as-a-foreign-language-Komplex nach wie vor rein englischsprachige Lehrwerke favorisiert.
Zu These 11
Die Folge ist eine kontraproduktive, wilde Verwendung der Muttersprache als ungewollte Nebenwirkung. Statt des verantworteten kalkulierten Gebrauchs der Muttersprache herrscht vielerorts der Missbrauch, den keiner will.”The floodgates open, and the mother tongue pours in.” Oder: "Wenn man dem Teufel den kleinen Finger reicht, nimmt er gleich die ganze Hand. Es sind immer wieder Stunden zu beobachten, die ganz unnötigerweise zu einem hohen Prozentsatz in der Muttersprache durchgeführt werden – ein Unding" (z.B. Johnstone 2002: 173). Manchmal werden dem Besucher auch Mogelpackungen serviert. Es fällt kein deutsches Wort, es wird aber auch nicht frei und mitteilungsbezogen kommuniziert. Ich meine aber, die Dammbrüche, vor denen die Direktmethodiker warnen, haben sie zum Teil selbst zu verantworten. [5]
Die Proteste der Schüler, die im FU nicht mitkommen, weil über ihre Köpfe hinweg geredet wird, sind bekannt. Wie muss es für Schüler sein, die das Gefühl haben, die Fremdsprache breche geradezu über sie herein? Haben wir es einmal selbst erfahren, wie es ist, wenn wir einer Sache überhaupt nicht gewachsen sind?
Ergebnisse einer Schülerbefragung von ca. 1300 Jungen und Mädchen der Klasse 9 an vier englischen Gesamtschulen:
One of the biggest frustrations for underperforming boys was not understanding the point of a lesson and what the teacher was trying to get them to do. This was particularly so when the lesson was solely or mainly conducted in the foreign language. ‘‘When a lesson is all in the target language, those underperforming hadn’t a clue what was going on. They were vociferous about that. The feeling of being lost in language lessons was so clear. It’s sad really. I had never thought of them not quite knowing what is going on. They may vaguely know, but not why they are doing it. (Thornton 1999: 11).
Englische Schüler haben es da besonders schwer. Viele haben kein Lehrbuch mit einem zweisprachigen Vokabelanhang. Aber auch in Deutschland klagen Schüler über erhebliche Verständnisschwierigkeiten in fremdsprachlichen Fächern, kritisieren, dass oft über ihre Köpfe hinweg unterrichtet wird, so etwa in einer von Hermann-Brennecke und Candelier durchgeführten Befragung (1992: 427). Dort heißt es über die Gründe bei der Abwahl von Fremdsprachen: „Die deutschen Probanden, die sich von Englisch trennen möchten, vermissten hochsignifikant Erklärungen auf deutsch.“ Wer nicht versteht, ist schnell frustriert. Geht man auf diese Befindlichkeiten nicht ein, ist das Scheitern vorprogrammiert. Aufgestaute Frustrationen explodieren: Lehrer und Schüler reden am Ende nur noch deutsch.
Natürlich gehen gewiefte Lehrer pragmatisch vor und finden einen auf ihre Person zugeschnittenen Kompromiss, der funktioniert. Wer heilt, hat recht, heißt es in der Medizin. Aber kann die Wissenschaft es dabei bewenden lassen? Es geht mir nicht um eine unverkrampfte Mitbenutzung und vorsichtige Tolerierung der Muttersprache, sondern um eine radikale Neubewertung und damit auch um die Mitverwendung ausgefeilter bilingualer Techniken im Rahmen eines fremdsprachlich durchgeführten Unterrichts. Außerdem kenne ich auch hardliner, oft Ausbilder und Schuldezernenten, die Referendaren gegenüber die offizielle Ideologie unmissverständlich geltend machen. Dazu kommen dann noch die native speakers, die die Muttersprache ihrer Schüler gar nicht kennen. In der Praxis eine unklare Gemengelage, die entstehen konnte, weil die theoretischen Grundlagen nicht stimmten.
Zu These 12
Die Verselbstständigung der
Fremdsprache aber geschieht
durch
ihre sinnvolle und vielseitige Verwendung,
nicht durch prinzipiellen Verzicht auf muttersprachliche Hilfen –
so wie man sich
auch erst allmählich an Preise in Euro gewöhnt.
Mit wachsendem Können macht sich die Muttersprache allmählich
von selbst überflüssig,
oder fast überflüssig. Die anfängliche punktuelle
Mithilfe der Muttersprache hindert nicht daran,
die Schüler immer wieder und immer mehr möglichst
realistischen
Situationen auszusetzen,
in denen sie von selbst, d.h. ohne
Rückgriffe auf die L1 klar kommen müssen.
„Das gekonnte Tun
ist qualitativ anders,“ (Butzkamm 2002: 75).
Dieser bekannte
psychologische Befund (neuerdings chunking-Theorie) wird
durch die moderne Hirnforschung bestätigt.
Bei der meisterlichen Ausführung sind andere Hirnregionen als beim
Anfänger
stärker aktiv,
so etwa auch beim Schachspiel (Amidzic u.a. 2001).
Der Gestaltwandel (und der Wechsel der Hirnregionen) wurde von einer älteren Assoziationspsychologie als Wegfall vermittelnder Zwischenglieder erklärt. Unbewusst vollzogene muttersprachliche „Anleihen“ werden weggekürzt.“The indirect bond (= the mother tongue) is shortcircuited out by practice just as memorial dodges for remembering people’s names are eliminated once the name is established“ (West 1962: 48). Das Problem, wie man die Geister, die man rief, auch wieder los wird, entsteht erst gar nicht, weil man mit der Muttersprache besser als ohne sie das erreicht, worauf es ankommt: viel qualitativ hochwertige kommunikative Kontaktzeit mit der Fremdsprache. Denn niemand kann der Zeit ein Schnippchen schlagen.
Relevante Ergebnisse aus der Spracherwerbsforschung
Befunde aus Nachbardisziplinen stützen unsere Theorie.
(1) Bei natürlicher Zweisprachigkeit, besonders beim doppelten Erstspracherwerb, helfen beide Sprachen einander aus, ergänzen sich wechselseitig und stören sich viel weniger, als man angenommen hatte. Von den zahlreichen Studien über zweisprachig aufwachsende Kinder seien Saunders (1988) und Tracy (1996) genannt, die den Punkt wechselseitiger Beförderung der Sprachen hervorheben, sowie Jeuks Studie über türkisch-deutsche Vorschulkinder. Die erfolgreicheren Kinder „greifen ausgiebiger auf ihre Fähigkeiten in der Erstsprache zurück, um die Kommunikation aufrecht zu erhalten.“ (Jeuk 2003: 19). Ich beschränke mich auf ein Beispiel, das zeigt, wie bilinguale Kinder ihre sprachliche Welt ordnen und wie beide Sprachen einander stützen. Alison und ihr Bruder Allan haben einen deutschen Vater und eine englische Mutter und leben in Deutschland. Alison (persönliche Mitteilung) berichtet: "Because it was our mother we were with most of the day, we naturally learnt most of the words in English.Very often, however, we used to ask: 'What does Papi say?'.Then our mother would give us the German equivalent.We developed a kind of ritual. For instance, when we learned the word cauliflower and its German equivalent, we folded our little hands above our heads and walked in single file through the house, singing at the top of our voices: 'Mami says cauliflower, Papi says Blumenkohl!' We walked up and down the stairs half a dozen times, entering each room." Auch Sprachmischungen mit spontanen Lehnbildungen (ital. „Dammi il gabelo“) sind ein natürliches Durchgangsstadium zur Beherrschung der Fremdsprache. (Vgl. das Kapitel “Natürliche Zweisprachigkeit” in Butzkamm 2002: 26ff.)
(2) Die Psycholinguistik postuliert eine “generalized capacity to process syntax“, die sowohl beim Muttersprach- und Fremdspracherwerb mitspielt, so z.B. Skehan (1989: 33). Deshalb ist Fremdsprachenbegabung schon an der Muttersprache ablesbar. Ganshow & Sparks (2001: 87) fassen diesbezügliche Studien zusammen: “Native language skills in the phonological / orthographic, syntactic, and semantic codes form the basic foundation for FL learning.” Die Muttersprache ist die Basis, ohne die kein weiterer Schritt gelingt, auch der in die Fremdsprache nicht. Wir sollten die Schüler nicht dabei sich selbst überlassen, sondern auf kluge Weise unterstützen.
Bilinguale Praxis
Hält die Praxis, was die Theorie verspricht? Es gibt eine Vielfalt bilingualer Praxen. Sie gehören aber keineswegs zum Standardrepertoire von in der Ausbildung vermittelten Techniken. Man muss sie sich aus einer überquellenden methodischen Literatur zusammen suchen. Manche „historische“ Arbeitsformen brauchen nur ein wenig aufpoliert zu werden. Sie hier in verständlicher Form aufzuführen, geschweige denn zu erläutern, würde den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen. Erwähnt seien nur sechs mir besonders wichtig erscheinende Verwendungsweisen der Muttersprache, die ihre geschichtlichen Vorgänger haben und in unterschiedlichen Unterrichtskontexten jeweils Unterschiedliches leisten:
- In bilingualen Kindergärten, etwa des Elsaß, werden die Kinder zur Hälfte auf französisch, zur Hälfte auf Deutsch betreut, und zwar von jeweils verschiedenen Erzieherinnen, die nur ihre jeweilige Muttersprache gebrauchen. Das sieht nach Einsprachigkeit aus, aber: Die Kinder antworten eine Zeitlang nur in ihrer Muttersprache, und wachsen dann langsam in die Zweitsprache hinein. Das ist Tradition: „Die Sprachmeister sprachen ihren Zöglingen französisch vor, fragten sie französisch...und ließen ihre Schüler – anfangs noch mit viel deutschen Worten untermischt – allmählich französisch antworten“ (Streuber 1914: 19). Diese Form der Mitbenutzung der Muttersprache wird auch in der deutsch-englischen Claus-Rixen Grundschule (Burmeister et al. 2002) praktiziert.
- Einstudieren und Vorspielen von Dialogen, wobei die Bedeutungen mit Hilfe muttersprachlicher Wort- und Satzäquivalente im Sandwichverfahren vermittelt werden. Dieses Verfahren erlaubt ebenso die frühe Verwendung authentischer Hör- und Lesetexte (Dodson 1967; Alexander & Butzkamm 1983).
- Einstudieren und Nachspielen von Filmszenen mit DVD – Fortsetzung der Dialogarbeit mit anderen Mitteln. Hierbei wird die muttersprachliche Tonspur ebenso mitbenutzt wie muttersprachliche Untertitel, die zugleich mit der Original-Fremdsprachen-Spur gezeigt werden.
- Zweisprachiges Vokabellernen (Phrasen, Kollokationen) im Verbund mit Körperlernen nach Schiffler (2002).
- Eine Lehrtechnik, die grammatische Strukturen durch muttersprachliche Spiegelung klärt. Italiener sagen „tre mese fa“, also „drei Monate macht’s“ statt „vor drei Monaten“ oder „qui si parla italiano“, „hier sich sprichtes italienisch“ = „hier spricht’s sich italienisch“ = „hier spricht man italienisch“ : Das ist grammatische Klärung ad usum delphini! (Kleinschroth 2000; Butzkamm 2000a).
- Halbkommunikative Strukturübungen, die das generative Prinzip des Spracherwerbs umsetzen (bilingual cue drills, translation pattern practice; Stannard Allen 1948/9; Butzkamm 2002b). [6]
- Das Übersetzen kurzer anspruchsvoller Texte in die Muttersprache. Wer Textverstehen als Schlüsselqualifikation ansieht, darf auf das Übersetzen, das aufmerksamstes Lesen erfordert, nicht verzichten. Es ist sowohl Sache des Fremdsprachen wie des Muttersprachenunterrichts und eine zentrale Arbeitsform des Lernfelds Sprache.
Es geht nicht darum, bewährte und eingeübte Techniken abzuschaffen, sondern darum, neue zuzulassen, und zwar bilinguale Techniken, die ja nicht nur mit der Semantisierung zu tun haben. Wenn solche Techniken in der Lehrerausbildung vermittelt und in der Praxis ausgeübt werden, wird man konkurrierende Techniken gegeneinander abwägen und neu verorten. Außerdem sollte man die Fantasie haben, sich neue Lehrwerke mit neuen Texten vorzustellen, wie sie uns die systematische und zugleich diskrete Mitwirkung der Muttersprache ermöglichen.
Schluss
Die Fremdsprachendidaktik hat wohl noch nicht das Stadium erreicht, in dem empirisch beantwortbare Fragen auch durch empirische Studien für alle überzeugend gelöst werden können. „Man beweist mit empirischen Untersuchungen, dass die Gruppe fruchtbarer ist als der einzelne, und man beweist mit empirischen Untersuchungen das Gegenteil” (von Hentig 1998: 22). Vielleicht liegt das schlicht am Geldmangel. Man vergleiche, wie viel aufwändiger Studien es bedarf, um ein ähnlich kompliziertes Problem in der Medizin oder auch das Problem der Auswirkungen von Gewaltdarstellungen im Fernsehen einwandfrei zu lösen. Meines Erachtens ist aber die vorgelegte Theorie so weit ausgebaut und abgesichert, dass nunmehr auch gehandelt werden muss. Den Schülern von heute ist mit einer Hinhaltetaktik nicht gedient. Die vorliegende Evidenz müsste genügen, die Einsprachigkeit radikal in Frage zu stellen und in amtlichen Richtlinien und Lehrwerken neue Wege zu öffnen. In vielen Fällen bietet die Muttersprache die optimale Lernhilfe. Schule und Wissenschaft sollten sich endlich von einem fundamentalen Irrtum befreien und die mehr als zweitausendjährige fruchtbare Allianz von Muttersprache und Fremdsprache wieder herstellen – ohne moderne Errungenschaften wie die fremdsprachige Unterrichtsführung zu verspielen. Man verstehe mich richtig: Dies ist kein Plädoyer für eine neue „Ausgewogenheit“. Mit einem Irrtum schließt man keinen Kompromiss. Man bereinigt ihn.
Anmerkungen
[1] Ich danke den Kollegen G. Aulmann, Y. Bertrand, D. Gohrbandt, H. Heuer, W. Hüllen, H.H. Lueger, R. Kleinschroth, H. Reisener, H. Sauer, L. Schiffler, G. Solmecke und G. Zimmermann für freundliche Unterstützung und kritische Kommentare zur Erstfassung dieses Aufsatzes.
[2] Wir alle neigen natürlich dazu, es uns bequem zu machen, nicht nur englische Muttersprachler: „Auch sollte sich der Lehrer bemühen, lernend in die Muttersprache seiner Schüler einzudringen. ‚Welche Sprache lernen Sie gerade?’, muss die ständige Frage an einen Lehrer für DaF sein.Wer darauf keine positive Antwort geben kann, sollte alsbald aus dem Verkehr gezogen werden, denn Sprachlernen gehört mit zu seiner Aus- und Weiterbildung. (Es gibt entsandte deutsche Lehrer, die zehn oder mehr Jahre im Orient waren, aber außer einigen Kommandos für ihre eingeborenen Dienstboten kein Wort der Landessprache kennen.).“ Schlenker (1985: 52).
[3] Beide Seiten , Europäer sowie Anglo-Amerikaner, sollten sich hier mal etwas einfallen lassen. Vgl. die Kritik des Kunst- und Musiksoziologen Alphons Silbermann (1992: 531) am „amerikanischen Spezialschrifttum, das, wie eine Bibelauslegung angesehen, alles, was an Gescheitem und Nützlichen aus anderen denn US-Forschungsstätten kommt..., bedenkenlos zu ignorieren versteht.“
[4] Robert Kleinschroth (Hölderlin-Gymnasium Heidelberg) hat in seiner achten Klasse neben dem Lehrwerkpensum den ersten Harry Potter Band besprochen (als Buch, Hörbuch und Film) und dazu 400 neue Vokabeln fast nur in Form von zweisprachigen Phrasenlisten eingespeist, die die Schüler bereitwillig geschluckt haben (Take the lot. Nehmen Sie alles; I won’t be long. Ich brauche nicht lange; I’m afraid so. Ich fürchte ja.). Mit herrlichem Erfolg. So kann die Zukunft aussehen!
[5] Ich betone: zum Teil. Es ist sattsam bekannt, dass auch einige Lehrer, nicht unbedingt fachfremd eingesetzte, einfach die Fremdsprache nicht gut genug beherrschen, um sie als Unterrichtssprache durchzusetzen. Das, fürchte ich, wird bleiben, solange wir kein Auslandssemester zur Pflicht machen dürfen und solange die Lehrveranstaltungen an der Hochschule nicht durchweg in der Fremdsprache durchgeführt werden.
[6] Diese und andere bilinguale Lehrtechniken sind detailgenau beschrieben und dokumentiert unter www.fremdsprachendidaktik.de.
Bibliographie
Alexander, L. & Butzkamm, W. (1983): Progressing from imitative to creative exercises: A presentation of the bilingual method. British Journal of Language Teaching Jahrgang??, H.21/1, 27-33.
Allen, S. (1948/9): In defence of the use of the vernacular and translating in class. English Language Teaching, ?, H. 3, 33-39.
Amidzic, O. et al. (2001): Active memory: pattern of focal bursts in chess players. Nature, ??, H. 412, 603.
Appel, J. (2000): Erfahrungswissen und Fremdsprachendidaktik. München.
Aronstein, P. (1926): Methodik des neusprachlichen Unterrichts. Erster Band. Die Grundlagen. (2.Aufl.) Leipzig.
Auerbach, E. (1993) : Reexamining English only in the ESL classroom. TESOL Quarterly, ??, H. 27, 1.
Bertrand, Y. (1999): Aspects du tutorat en langue étrangère. In: R. Metrich,A.Hudlett & H. Lüger (Hrsg.): Des racines et des ailes. Théorie, modèles, expériences en linguistique et didactique. Nancy, 297-306.
Brown, R. (1973): A first language: The early stages. Cambridge.
Bruton, A. (2003): How can TBI not contribute to language development? IATEFL Issues, ?, H. 170, 6.
Burmeister, P., Piske,T. & Rohde,A. (2002): An Integrated View of Language Development. Papers in Honor of Henning Wode. Trier.
Butzkamm, W. (1978): Aufgeklärte Einsprachigkeit. Zur Entdogmatisierung der Methode im Fremdsprachenunterricht. (2. Aufl.). Heidelberg.
Butzkamm, W. (1980): Praxis und Theorie der bilingualen Methode. Heidelberg.
Butzkamm, W. (1998): Codeswitching in a Bilingual History Lesson: The Mother Tongue as a Conversational Lubricant. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, ??. H 1/2 , 81-99.
Butzkamm, W. & Butzkamm, J. (1999): Wie Kinder sprechen lernen. Kindliche Entwicklung und die Sprachlichkeit des Menschen.Tübingen (u.a.).
Butzkamm, W. (1999):
Über die planvolle Mitbenutzung der
Muttersprache im Sachunterricht. In: R. Métrich, A.
Hudlett & H. Lüger (Hrsg.): Des Racines et des Ailes.
Théories,
Modèles, Expériences en Linguistique et Didactique.
Nancy.
Butzkamm, W. (2000a): Wie man die Sprache der Geliebten lernt. Englisch ??, H.1, 14.
Butzkamm, W. (2000b): Medium Orientated and Message Orientated Communication. In: M. Byram (Hrsg.): Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning. London and New York, 406-407.
Butzkamm, W. (2000c): Monolingual Principle. In: M. Byram (Hrsg.): Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning. London and New York, 415417.
Butzkamm, W. (2002): Psycholinguistik des Fremdsprachenunterrichts. Von der Muttersprache zur Fremdsprache. (3. neubearbeitete Aufl.). Tübingen.
Butzkamm, W. (2002b): Grammar in Action – The Case for Bilingual Pattern Drills. In: C. Finkbeiner (Hrsg.): Wholeheartedly English: A Life of Learning. Festschrift for Johannes-Peter Timm. Berlin, 163-175.
Caldwell, J. (1990): Analysis of the theoretical and experimental support for Carl Dodson’s bilingual method. Journal of multilingual and multicultural development, ?? H. 11, 459479.
Clark, H..& Clark, E. (1977): Psychology and Language. New York. Dodson, C. J. (1967/1972): Language Teaching and the Bilingual Method. London.
Erdmenger, M. (1982): Die Rolle der Muttersprache im Fremdsprachenunterricht. Die berufsbildende Schule, Jahrgang H. 6, 360-365.
Ganshowe, L. & Sparks, R. (2001): Learning difficulties and foreign language learning: A review of research and instruction. Language Teaching, ?? H. 34, 79-98.
Grosjean, J. (1984): Le bilinguisme: vivre avec deux langues. Travaux Neuchâtelois de Linguistique, ?? H. 7, 15-41.
Hammerly, H. (1989): French immersion. myths and reality. A better classroom road to bilingualism. Calgary (u.a.).
Hermann-Brennecke, G. & Candelier, M. (1992): Wahl und Abwahl von Fremdsprachen: Deutsche und französische Schüler und Schülerinnen im Vergleich. Die Neueren Sprachen, ??; 416-434.
Ishii, T. et. al. (1979): Experiment on the Acquisition and Retention of Sentence-Meaning and the Imitation Performance. Journal of the Kansai Chapter of the Japan English Language Education Society, ?? H. 3, 52-59.
James, C. (1972) :
Zur Rechtfertigung der kontrastiven Linguistik. In: G.
Nickel (Hrsg.): Reader zur kontrastiven Linguistik.
Frankfurt.
Jeuk, S. (2003): Die Satellitenschüssel im Wohnzimmer. Perspektiven und Vorurteile hinsichtlich Medienbenutzung und Spracherwerb bei türkischen Vorschulkindern. Flensburger Papiere zur Mehrsprachigkeit, ?? H. 30, 333.
Johnstone, R. (2002): Research on language teaching and learning: 2001. Language Teaching, ?? H. 35, 157-181.
Kaczmarski, S. P. (1988): Wstep do bilingualnego ujecia nauki jezyka obcego. Warsaw.
Kasjan, A. (1995):
Die bilinguale Methode im Deutschunterricht
für japanische Studenten I.
Die Einführung in die Textarbeit. Gengobunka Ronkyu, H.
45, 159-171.
Kasjan, A. (1996): Die bilinguale Methode im Deutschunterricht für japanische Studenten II. Die Einführung in die Textarbeit. Gengobunka Ronkyu, H. 7 125-142.
Klein, H. G. & Stegmann,T. D. (2000): Euro-Com-Rom – die sieben Siebe. Romanische Sprachen sofort lesen können. Aachen.
Kleinschroth, R. (2000): Sprachen lernen. Der Schlüssel zur richtigen Technik. Reinbek bei Hamburg.
Kukulka, D. (1982): A Bilingual Technique for Teaching Technical Vocabulary to Higher Technical School Students. English Teaching Forum, 20/2.
McDonough, J. (2002): The teacher as language learner: worlds of difference? English Language Teaching Journal, Jahrgang, H. 56/4, 404– 411.
Meijer, T. (1974): De globaalbilinguale en de visualiserende procedure voor de betekenisoverdracht. Een vergelijkend methodologisch onderzoek op het gebied van het aanvangsonderwijs frans. Amsterdam.
Meißner, F.J. (2000): Orientierung für die Wortschatzarbeit. Französisch heute 31, 624.
Oskarsson, M. (1973): Assessing the relative effectiveness of two methods of teaching English to adults. IRAL, ?, H. 3, 251261.
Prodromou, L. (2002):The role of the mother tongue in the classroom. IATEFL Issues, ?, H. 45, 68.
Richards, J.C. (1984): The secret life of methods. TESOL Quarterly, H. 18, 723.
Ridjanovic, M. (1983): How to Learn a Language, Say English, in a Couple of Months. English Teaching Forum 21, H. 1, 814.
Rinvolucri, M. (1990): Translation as Part of Learning a Language. Practical English Teaching 10, H. 4, 26-27.
Sastri, H.N.L. (1970): The Bilingual Method of Teaching English – an Experiment. RELC Journal, H. 2, 24-28.
Saunders, G. (1988): Bilingual children: from birth to teens. Clevedon, Philadelphia.
Schiffler, L. (2002): Fremdsprachen effektiver lehren und lernen. Beide Gehirnhälften aktivieren. Donauwörth.
Schlenker, W. (1985): Heinz Griesbachs
streitbare
Äußerungen
über das Buch von Herrad Meese: Systematische
Grammatikvermittlung und Spracharbeit im Deutschunterricht
für ausländische Jugendliche. Zielsprache Deutsch,
?, H. 4, 50-52.
Silbermann, A. (1992): Verwandlungen. Bergisch-Gladbach.
Skehan, P. (1989): Individual differences in second-language learning. London.
Solmecke, G. (2000): Verständigungsprobleme im Englischunterricht. In: A. Addison & K. Vogel (Hrsg.): Fremdsprachen in Lehre und Forschung 26. Bochum, 305-326.
Streuber, A. (1914): Beiträge zur Geschichte des französischen Unterrichts im 16. bis 18. Jahrhundert. Berlin.
Thornton, K. (1999): Teenage boys lost in French. Male pupils are losing the plot in foreign language lessons which they do not consider to be very important. Times Educational Supplement, October 8, 11.
Toth, E. (1973): Das Problem der Kontrastivität im Englischunterricht. Zielsprache Englisch, Jahrgang, H. 2, 915.
Tracy, R. (1996): Vom Ganzen und seinen Teilen. Überlegungen zum doppelten Spracherwerb. Sprache und Kognition, Jahrgang, H. 15, 70-92.
von Hentig, H. (1998): Kreativität. Hohe Erwartungen an einen schwachen Begriff. München.
Walatara, D. (1973): Experiment with the Bilingual Method for Teaching English as a Complementary Language. Journal of the National Science Council of Sri Lanka, Jahrgang, H. 1, 189-205.
West, M. (1962): Teaching English in difficult circumstances. Teaching English as a foreign language with notes on the techniques of textbook construction. London.
Berichte, Verbände, Institutione
Neues zur Lehrerfortbildung in Kanada: Das Multiplikatorennetzwerk Kanada
André Oberlé, Winnipeg
Schon vor längerer Zeit, an einem recht kalten Wochenende im Januar 2004, begannen am Goethe-Institut Toronto die Vorarbeiten zu einem erneuten Versuch, die Fortbildung von Deutschlehrerinnen und -lehrern auf nationaler Ebene in Kanada zu fördern.
Nach eingehenden Recherchen zu bisherigen Versuchen, die Lehrerfortbildung in Kanada auf nationaler und regionaler Ebene zu fördern, hatte das Goethe-Institut Toronto schon in den vorhergehenden Monaten einen Antrag beim Ständigen Ausschuss für Deutsch als Fremdsprache (StADaF) gestellt, um dieses Treffen und die weiteren Schritte zur Förderung dieses wichtigen Anliegens unternehmen zu können. Eingeladen zu dem Treffen in Toronto vom 22. bis 27. August 2004 waren die beiden Fachberater für Kanada, Repräsentanten der Goethe-Institute und einige Fortbilder/innen, die sich bisher besonders für die Fortbildung von deutschen Lehrkräften auf regionaler und nationaler Ebene eingesetzt hatten. Als Moderator wurde Ekkehard Sprenger vom Goethe-Institut San Francisco eingeladen, der schon mit großem Erfolg ein Multiplikatorennetzwerk an der Westküste der USA aufgebaut hat. Ruth Renters, verantwortlich für die pädagogische Verbindungsarbeit am Goethe-Institut Toronto, hatte alles vorbildlich organisiert und für eine gute Arbeitsatmosphäre gesorgt.
Bei diesem Treffen wurde eingehend diskutiert, wie man mit den immer geringer werdenden finanziellen Mitteln und den schon existierenden Ressourcen die Fortbildung für Deutschlehrer/innen in Kanada neu anregen und weiter entwickeln könnte. Dabei kamen die Teilnehmer zu dem Entschluss, ein kanadaweites Netzwerk für Multiplikatoren einzurichten. Die zugrunde liegende Idee ist, dass Multiplikatoren in regelmäßigen Abständen auf nationaler Ebene zusammen kommen, sich bei dieser Gelegenheit fortbilden und dann auf regionaler Ebene ihre neu erworbenen Kenntnisse an die Kolleginnen und Kollegen in ganz Kanada weitergeben. Die Teilnehmer/innen am Torontoer Treffen beschlossen, im August 2004 ein einwöchiges Seminar für Fortbilder/innen in Kanada zu veranstalten, um schon aktive Fortbilder/innen zu einer Fortbildungsveranstaltung zusammen zu bringen und die Basis für ein Netzwerk zu schaffen. Ekkehard Sprenger wurde eingeladen, auch dieses Seminar zu moderieren. Als zentral gelegener Seminarort wurde das Galilee Retreat Centre in Arnprior, in der Nähe von Ottawa, ausgewählt. Dieser Seminarort erschien am preisgünstigsten und geeignetsten. Ruth Renters kümmerte sich wieder auf vorbildliche Weise um die Logistik. Alles lief wie am Schnürchen, und die Resultate übertrafen alle Erwartungen. Überhaupt war die Atmosphäre in Arnprior ausgesprochen kollegial und locker und bei allem ging es sehr humorvoll zu. Alle waren motiviert zu arbeiten, mussten auch tatsächlich sehr viel arbeiten und hatten dabei enorm viel Spaß. Auch nicht unwichtig war die schöne Lage des Tagungsortes, am Ottawa-Fluss. Die parkähnliche Anlage lud geradezu zu philosophischen Spaziergängen ein und regte die Reflexion und Diskussion auch außerhalb der offiziellen Seminarstunden an. Die Räumlichkeiten waren ideal und schienen eigens für dieses Seminar geschaffen. Dass die Schlafzimmer sehr bequem und die kulinarische Betreuung sehr gut waren, darf auch nicht unerwähnt bleiben, weil alles zusammen eine ideale Arbeitsatmosphäre schuf.
Wer war dabei? Die Liste der Teilnehmenden liest sich wie ein “Who’s Who” der Fortbilder/innen. Ekkehard Sprenger (Moderator) und Ruth Renters (Seminarleitung), Gerda Alexander (Alberta), Ellen Black (Saskatchewan), Cheryl Dueck (Manitoba), Silke Falkner (Saskatchewan), Kim Fordham (Alberta), Anette Guse (Ontario), Alexandra Heberger (Manitoba), Isolde Hey (Britisch Kolumbien), Walter Kampen (Manitoba), Helma Kroeh-Sommer (Québec), Eva Ledwig (Ottawa), André Oberlé (Manitoba), Hildegard Schieweck (Ontario), Bernd Schliephake (Fachberater: Kanada-Ost), Carsta Vogel (Mexiko), Thomas Voss (Atlantische Region), Mark Waldner (Manitoba), Brigitte Werner (Alberta). Somit waren nicht nur so ziemlich alle Regionen Kanadas vertreten, sondern auch alle Lehrstufen abgedeckt.
Das Fortbildungsseminar hatte zwei wichtige Ziele, die gleichermaßen erreicht werden sollten. Vor allem sollten die Teilnehmer/innen selbst in praktischen methodischen Fragen zum DAFUnterricht fortgebildet werden. Dabei sollten ganz konkrete und im Unterricht einsetzbare Einsichten gefördert und die zu Grunde liegenden pädagogischen Fragen behandelt werden. Ebenfalls wichtig war es, die Diskussion darüber einzuleiten, wie das kanadische Multiplikatorennetzwerk aussehen solle, wie die Mitglieder in aktiver Verbindung bleiben können und welche Rolle die regionalen und nationalen Lehrerverbände dabei spielen sollen.
Im Seminarprogramm wurden folgende Schwerpunkte behandelt: Theatertechniken im Deutschunterricht, Landeskunde, kreativer Wortschatzunterricht, Simulationen im Deutschunterricht, kommunikative Aktivitäten und Spiele, Bilder und Lieder und Literaturformen im Unterricht. Das alles wurde beispielhaft als kommunikativer Unterricht vermittelt. Aktives Lernen wurde jederzeit gefördert. Anhand von Arbeitsblättern und Aktivitäten in Arbeitsgruppen wurde alles erarbeitet und jeweils im Plenum vorgestellt. Hervorzuheben ist, dass es stets Gelegenheit gab, über die Lernziele und Übungsformen zu reflektieren und dabei aufkommende Fragen zu klären. Viele der Teilnehmenden brachten selbstverständlich schon ein umfangreiches Wissen zu diesen Themen mit, erhielten aber besonders in den Diskussionen viele neue Anregungen und Bestätigungen der Legitimität der eigenen Unterrichtspraxis.
Bei der Frage, wie das Netzwerk aussehen solle und wie man in Verbindung bleiben wolle, ergab sich einstimmig, dass man sich regelmäßig als ganze Gruppe treffen solle, aber auch supraregionale Treffen für den Osten und Westen Kanadas organiseren solle. Es wurde also vereinbart, dass man sich als ganze Gruppe wiederum im August 2005 treffen werde. In der Zwischenzeit will die Gruppe elektronisch in Verbindung bleiben. Es wurden dazu ein Listserv und ein Online-Archiv für wichtige Dokumente eingerichtet. Dass die regionalen und nationalen Verbände mit dem Netzwerk zusammen arbeiten müssen, wurde ebenfalls beschlossen. Als erster Schritt soll dazu ein Katalog der schon vorhandenen Forbildungsexperten aufgestellt werden, in dem auch die Themen aufgelistet werden, für die ab sofort von Experten geleitete Workshops angeboten werden.
Somit wurden also beide Seminarziele erreicht. Die Teilnehmer/innen gingen nicht mit leeren Händen nach Hause. Für die vielen Handouts mit unterrichtsbezogenen Materialien war fast ein zusätzlicher Koffer von Nöten. Der Listserv und das Online-Archiv sind inzwischen eingerichtet worden, die Arbeit am Katalog der verfügbaren Workshops hat begonnen, und neue Anträge auf finanzielle Unterstützung für die Fortsetzung dieser Fortbildungsarbeit werden zur Zeit vom Goethe-Institut Toronto gestellt. Die Arbeit geht also weiter.
Natürlich gab es auch ein Rahmenprogramm bei dieser Veranstaltung. So trafen sich die Teilnehmer/innen gleich am ersten Abend, um sich besser kennen zu lernen und am letzten Abend, um sich in einer kleinen Feier zu verabschieden. Am Mittwoch fuhren alle Teilnehmer/innen nach Ottawa, um sich eine Ausstellung im National Museum of Art, zum Thema “Der Clown”, anzusehen. Dabei gab es auch ein Treffen mit einem Kurator des Museums, der erläuterte, wie man Kunst im Unterricht auf kreative Weise einsetzen könne. Ein modernes Gemälde aus der ständigen Ausstellung wurde dazu als Beispiel eingesetzt. Die Besucher erhielten bei dieser Gelegenheit auch Adressen und Links zur Weiterverfolgung dieses Themas. Ein Besuch beim Goethe-Institut in Ottawa schloss sich dem Museumsbesuch an. Dass dieser Ausflug auch zu vielen Arbeitsgesprächen und neuer Vernetzung Anlass gab, versteht sich von selbst.
Nicht nur das Seminarprogramm und das Rahmenprogramm sorgten für regen Kontakt unter den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Es gab auch genügend Gelegenheiten beim Essen und in den Pausen, sich mit Kollegen und Kolleginnen zu unterhalten und wichtige Informationen auszutauschen. Dieser Aspekt der kollegialen Zusammenarbeit wird leider bei vielen Fortbildungsveranstaltungen entweder völlig übersehen oder nicht hinlänglich berücksichtigt.
Während, wie schon erwähnt, ein weiteres Seminar für die “Multis”, wie wir uns gerne nennen, für den nächsten Sommer geplant ist und möglicherweise in der Zwischenzeit regionale Veranstaltungen stattfinden werden, wird gleichzeitig erwartet, dass die Multis ihre neuen Erfahrungen und Erkenntnisse schon bald in der eigenen Region, mit ihren Kolleginnen und Kollegen, in eigens dafür eingerichteten Workshops teilen werden.
Der Erfolg des Netzwerks wird natürlich von der Kooperations- und Arbeitsbereitschaft der Teilnehmenden und der Lehrerschaft Kanadas abhängen. Eine gute Basis dafür ist allerdings geschaffen. Das Goethe-Institut spielt dabei eine führende und lobenswerte Rolle. Es ist äußerst ermutigend und sehr zu begrüßen, dass StADaF dieses Projekt rege unterstützt.
Traum und Wirklichkeit—Jogging im Schlosspark Schönbrunn. Mein Sprach-Rendezvous in Wien 2003
Luciana Popp, Edmonton
Alles fing in Luzern, während der XII. Internationalen Tagung für Deutschlehrer, im August 2002 an. Dort traf ich nach acht Jahren Frau Gertrude Zhao-Heisenberger vom Österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur wieder. Am Informationskiosk Österreich bot sie unter anderem Material über Lehrerfortbildungsseminare für das darauffolgende Jahr 2003 an.
Phantastisch, dachte ich, das wird mein Sommerurlaub im nächsten Jahr. Meine Erinnerungen an die Teilnahme an einem ähnlichen Programm im Jahr 1994 schienen noch ganz frisch zu sein. Damals begleitete mich Brigitte Werner (die wie ich selbst aus Edmonton kommt), und wir beide waren von unserem Aufenthalt begeistert. Diesmal jedoch versuchte ich ohne Erfolg einige Lehrer aus Edmonton von dem Seminar zu überzeugen. So entschloss ich mich, alleine nach Wien zu fliegen.
Meine Erwartungen an und Vorstellungen von diesen Fortbildungskursen im Sommer unterschieden sich sicher nicht sehr von denen anderer Lehrer: ERHOLUNG – ENTSPANNUNG – INFORMATIONSAUSTAUSCH – BEREICHERUNG DER SPRACHKENNTNISSE – KULTURELLE BEREICHERUNG – WISSENSBEREICHERUNG.
Und wie die meisten Lehrer sah ich einem physischen und psychischen Abstand von dem "TYPISCH SCHULE"-Klischee mit Freude entgegen.
Das österreichische Bundesministerium bot für den Sommer 2003 acht Seminarprogramme mit unterschiedlichen Schwerpunkten an. Meine Überraschung war riesig, als ich unter ihnen auch mein Lieblingsthema fand: "Traum und Wirklichkeit. Kunst und Kultur um 1900". Der stichwortartige Überblick im Internet versprach Informationen aus den Bereichen Geschichte, Musik, Kunst und Literatur sowie auch ein interessantes Unterhaltungsprogramm in Wien und Payerbach.
Ohne zynisch oder sarkastisch klingen zu wollen, stellte ich fest, dass dieser Fortbildungskurs für mich wie 'ein Traum in der Wirklichkeit' war. Die günstige Unterkunft mit phantastischer Verpflegung im Pallottihaus (Wien, 13. Bezirk, Hietzing) erlaubte mir täglich, eine Stunde im Schlosspark Schönbrunn zu joggen. Die Seminarleitung, Frau Mag. Maria Marizzi und Herr Mag. Norbert Ross, kümmerten sich hervorragend um das Organisatorische. Das Programm wurde von ihnen selbst vorbereitet und zusammengestellt. Dazu gehörten zum Beispiel Vorträge über die Österreichisch-Ungarische Monarchie, die Geschichte Wiens als eine multikulturelle Stadt, Referate und Aufführungen über Musik (und mit Musik) um 1900, Ausflüge, Kunst- und Architekturführungen und Treffen und Lesungen mit einigen Schriftstellern.
Zu den Aufgaben der Teilnehmer gehörte vorwiegend zu diskutieren, sich zu äußern, zu fragen und mitzumachen. Die einzige „schwere Arbeit" war die Recherche-Aufgabe zu Kaffeehäusern als literarische Orte.Wir wurden in Vierer-Gruppen aufgeteilt. Zu meiner Gruppe gehörten Carmen (Spanien), Irena (Kroatien) und Harum (Indonesien). Von unserer Gruppe wurde das 'Café Prückel' am Stubenring 24 ausgelost. Während des Abendseminars sollten wir der Seminargruppe drei Berichte vortragen:
a)
die Geschichte und die Ausstattung des Kaffeehauses,
b) Beschreibung der Kaffeesorte 'Verlängerter" (=schwarze Melange),
c)
Beschreibung des Gespräches mit einem Besucher/ einer Besucherin
des Cafés.
Die letzte Aufgabe machte uns viel Spaß. Ich musste dabei jedoch leider feststellen, dass ich mich in Kanada, in den letzten 16 Jahren nach meiner Immigration nach Edmonton/Alberta, zu einer sehr scheuen Kanadierin entwickelt habe. Ich hatte nämlich Hemmungen, fremde Personen im Café anzusprechen. Der Spanierin und der Kroatin fiel das viel leichter.
Den Abschlussabend in Wien verbrachten wir beim Heurigen in einem Bauernhofrestaurant. Dafür gesellte sich auch Frau Gertrude Zhao-Heisenberger vom Bundesministerium zu uns.
Die restlichen 5 Tage genossen wir in Payerbach/ Reichenau, ca. 1,5 Stunden Busfahrt südwestlich von Wien entfernt. Frische Alpenluft, Ausflüge auf die Rax und ins Höllental, Exkursionen auf den Spuren von Impressionisten wie Schnitzler, Werfel und Mahler, Theaterbesuche, Leserunden und Vorträge von Literaturexperten bereicherten und erfrischten nicht nur unseren Geist, unsere Seele und unseren Körper, sondern auch unsere Sprachkenntnisse, die ja im Laufe des Schuljahres schnell geschwächt werden können.
Die 24 Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieses Seminars kamen aus 16 Ländern und 3 Kontinenten. Ich war die einzige aus Kanada. Drei Personen kamen aus den USA. Die älteste Teilnehmerin, Frau Elsie Green aus Long Island (USA), 91, war Ehrengast. Sie verließ Wien 1936, wohnte zuerst in Kanada und zog später nach New York.
Unheimlich interessant fand ich auch die Erfahrungen, die sich aus dem Austausch mit anderen Kursteilnehmern ergaben und die Informationen über Deutsch und Fremdsprachenunterricht, Schulprobleme, Schulalltag, die Lehrersituation und Lehreraufgaben/Anforderungen in allen diesen 16 Ländern.
Zu den Dingen, die mir negativ auffielen, gehörte das Zigarettenrauchen auf den Strassen und an vielen öffentlichen Plätzen. Auch bemerkte ich mit Erstaunen, dass jetzt in Europa überall viele Leute mit Kaugummi im Mund herumlaufen. (Amerikas Kultureinfluss macht sich da leider sehr bemerkbar).
Zu meinem Bedauern vergaß ich auch, für meine Freundin Brigitte und ihre Mutter eine Sachertorte aus Wien mitzubringen.
Die Frage der Kosten für dieses Seminar ist auch wichtig. 1994 bezahlte ich als Anmeldebeitrag (für 13 Tage) nur Can $350. Diesmal betrug der Anmeldebeitrag ca. Can $ 1,200, also etwa 700 Euro. (Einbezogen sind Unterkunft, Verpflegung, Seminaraktivitäten). Für den Flug nach Wien bezahlte ich Can $ 1,360; meine Taschengeldausgaben überschritten nicht Can $ 700. Leider bekam ich für diesen Fortbildungskurs keine finanzielle Unterstützung, obwohl ich mich darum überall bewarb (Schulverwaltung, „Individual Teacher Bursary Program“).
Meinen Aufenthalt in Österreich verband ich mit meinem privaten Urlaub: unter anderem mit einem Besuch von Freunden und Familie in Österreich, Deutschland und England.
Summa summarum: trotz der hohen Kosten bin ich mit meiner Entscheidung, am Seminar "Traum und Wirklichkeit" teilzunehmen, unheimlich zufrieden.
Gleichzeitig danke ich dem österreichischen Ministerium, Abteilung Sprache und Kultur, wie auch der Seminarleitung Maria und Norbert dafür, dass sie diese Seminarprogramme organisieren. Ich beende meinen Bericht in der Hoffnung, dass sie das weiter für uns Deutschlehrer im Ausland tun werden.
Jetzt sitze ich vor meinem Computer, und in meinem Kopf entwerfe ich schon Pläne für meinen nächsten Fortbildungskurs in Österreich im Jahr 2005, den ich jedem Deutschlehrer/Lehrerin in Kanada empfehlen möchte.
Genauere Informationen über Fortbildungskurse in Österreich finden Sie unter der Adresse www.kulturundsprache.at.
Bericht über die KVDS-Fortbildungskonferenz in Vancouver, 14.-16. Mai 2004
Ilona Beck und Christine Hörger, Rouleau
Hier eine kurze Zusammenfassung über die herrlichen Tage in Vancouver.
Da die einzelnen Teilnehmer/innen im
Laufe des Freitags
per
Flugzeug/Auto/Bus zu den unterschiedlichsten Zeiten ankamen,
trafen sich kurzerhand bereits einige interessierte und nicht
ortskundige Damen und Herren zu einer Führung im anthropologischen
Museum auf dem Unigelände – und es hat sich gelohnt!
Auf den „Spuren des Raben“ wurden wir mit den
Unterschieden zwischen den einzelnen Indianerstämmen und
deren Traditionen vertraut gemacht.
Die dafür angesetzte Zeit
war natürlich viel zu kurz.
Doch werden einige beim nächsten
Besuch in Vancouver dieses Museum bestimmt wieder aufsuchen.

Am Abend fand dank des Generalkonsulats Vancouver ein Empfang statt, und Herr Generalkonsul Hans Michael Schwandt begrüßte alle Konferenzteilnehmer/innen aus Nah und Fern. Bei Wein und köstlichen Häppchen konnten sich die einzelnen Lehrer/innen kennen lernen bzw. wiedertreffen.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Verabschiedung unseres Fachberaters Karli Süss.
Sabine Häfke hatte fleißig gedichtet und komponiert und einer kleinen Gruppe von uns schnell im Gebüsch vor dem Museum die entsprechenden Zeilen beigebracht. Eine tolle Leistung, Sabine! So sangen wir dem Karli ein Abschiedslied über seine sechs Jahre als Fachberater. Es war ein lustiger Abend und natürlich hatte Karli seine Gitarre mitgebracht, um uns ein letztes Mal zu besingen. Wir werden es vermissen!

Der Samstag fing gleich um acht Uhr mit einem guten Frühstück an, bei dem es alle möglichen Leckereien wie Obst, Hörnchen und Muffins für alle Geschmäcker gab sowie natürlich den unvermeidlichen Kaffee oder Tee. Ein eifriges Schnattern lag über dem Raum, und Ilse Spangenberg musste öfters an ihr Wasserglas klopfen, bevor die Konferenzteilnehmer zur Ruhe kamen. Denn gleich nach dem Frühstück fing die Arbeit für alle an: Die Workshopleiter sowie die Teilnehmer waren den ganzen Tag beschäftigt. Zuerst hörten wir von Ilse Spangenberg einige Daten über die Organisation des KVDS und andere administrative Angelegenheiten, gefolgt von den verschiedensten Workshops: „Unterrichtsmaterialien erprobt im Unterricht ab 9. Klasse“ von Hildegard Schieweck, „Grammatik spielerisch“ von Bernd Schliephake und besonders auch „Galli Theater“ von Katharina Riemann, wo alle Teilnehmer aktiv mitmachen mussten, was mit viel Lachen verbunden war.
Nach der ersten Kaffeepause war André Oberlé mit „Portfolios zur Förderung der Sprachkompetenz“ dran, was allgemein als sehr interessant, humorvoll und ansprechend präsentiert empfunden wurde.
Nach dem Mittagessen, das auch wieder sehr liebevoll vorbereitet worden war (vielen Dank an Isolde Winter und Sohn!), sprach Karli Süss über den Schüleraustausch Kanada/Deutschland. Danach hörten wir etwas über das Multiplikatorennetzwerk von Ruth Renters (Goethe Toronto). Dann folgte der Workshop „Wie plant man ein Schülerprojekt von Anfang bis zum Ende“ von Brigitte Martin–Mendonça, und nach einer weiteren Kaffee- und Kuchen-Pause (wir müssen alle sehr müde gewesen sein!) hörten wir von Gerlinda Ringe einen Vortrag über die Grundlagen des Fremdsprachenunterrichts. Zuletzt wurden Zeugnisse von den verschiedenen deutschen Sprachschulen in Kanada gezeigt und besprochen.

Kaum hatten wir uns von unseren Stühlen erhoben, um uns etwas die Füße zu vertreten, da stand auch schon der Bus zur Stadtrundfahrt vor der Tür des St. Mark’s College. Wir konnten die Baukonjunktur im Zentrum Vancouvers bewundern und unser Busfahrer, ein Mitglied der „First-Nation“ Leute, gab außerordentlich interessante Erklärungen über die verschiedenen Totempfähle ab, die wir im Stanley Park bewundern konnten. Natürlich hatten wir eine tolle Sicht auf die farbreiche Blumenpracht, und ganz besonders die blühenden Rhododendrons waren die Fahrt wert. Das war ein sehr schöner Abschluss des Samstags, zusammen mit dem anschließenden Essen beim Chinesen.Was war das für ein uriges Erlebnis! Zehn Leute saßen an einem runden Tisch – wir hatten übrigens vier Tische belegt – etwas eingeengt, aber die Stimmung war äußerst heiter, und es fehlte nicht an Kommentaren über das einmalig authentische chinesische Essen. Offensichtlich war das Motto Soßen, und wahrscheinlich können wir uns noch alle an den Soßenhummer auf Nudeln erinnern. Nachdem wir alle gut gesättigt waren, fuhren wir zurück zur UBC, um unsere müden Knochen auszuruhen.
Nach einem herzhaften Frühstück fand am Sonntag die KVDS-Jahresversammlung statt.
Anschließend wurde der LEITFADEN, ehemals von Fachberater Rupert Barensteiner ins Leben gerufen, kritisch diskutiert. Viele Schulen nutzen ihn als sog. Rahmenplan und finden ihn als solchen sehr wertvoll. Leider reichen zu wenig Lehrkräfte eigene Materialien ein, um daraus eine Materialsammlung entstehen zu lassen. Eindeutig ist das Copyright ein Grund dafür. Es wurde eine weitere Arbeitskonferenz vorgeschlagen, um die Arbeit mit dem LEITFADEN zu aktualisieren.
Rückblickend war die Konferenz ein großer Erfolg. Informationen wurden ausgetauscht, Kontakte geknüpft und neue Initiativen und Ideen für das neue Schuljahr mit nach Hause genommen.

Stadtrundfahrt am Samstag
APAQ-Bericht zur CATG: Sonntag, den 8.2.2004
Marie-Josée Martineau, Montréal
Die APAQ hat ungefähr 65 Mitglieder. Wir haben zweimal im Jahr eine Tagung (im Frühjahr und im Herbst). Zu Beginn unserer Tagungen werden neu erschienene Lehrwerke von Bärbel Becker (GI Montreal) ausgestellt. Ein Fortbildungsseminar oder workshop schließt sich an. Danach folgen unsere Geschäftssitzung und ein gemeinsames Abendessen. Abends gibt es entweder einen Film oder eine Lesung von einem geladenen Schriftsteller.
Da in Quebec Deutsch (mit einigen Ausnahmen) nicht an Sekundarschulen unterrichtet wird, gibt es eine Arbeitsgruppe, die für Lobbyarbeit zuständig ist und Kontakte mit Schulen und Schulbehörden aufnimmt und pflegt. Mit der Reform gibt es wieder Hoffnung für Deutsch in der Sekundarstufe, denn das Erziehungsministerium plant, das Erlernen einer dritten Fremdsprache in den Niveaus 3-4-5 (entsprechend Kl. 9-10-11) einzuführen.
BCCTG-Jahresplan
Axel Rechlin, Vancouver
Letztes Jahr war ein sehr abwechslungsreiches Jahr für die BCCTG, denn wir hatten Anfang des Jahres gerade mal drei Mitglieder. Wir rafften uns auf, entwarfen einen „DIALOG“ und forderten alle Deutschlehrer(innen) auf, uns entweder beizutreten oder den Untergang der BCCTG mitzuerleben. Momentan haben wir 32 Mitglieder und ein Neuanfang scheint gemacht zu sein. Ich glaube einer der Gründe, warum die BCCTG solche Probleme hat(te), war die Schließung des Goethe-Institutes vor einigen Jahren. Danach haben die Universitäten, KVDS und Sekundärschulen sich mehr und mehr von uns zurück gezogen und nur noch ihre eigenen Interessen verfolgt.
Anfang des Jahres hatten wir eine Jahresversammlung, an der auch Isolde Hey (SFU und Goethe Center) und Dagmar Cox (Samstagsschule) teilnahmen. Beide waren sehr motiviert, dem BCCTG unter die Arme zu greifen. Wir sind gerade dabei einen "listserv" zu erarbeiten. Dieses Projekt wurde bereits vor einigen Jahren begonnen, hat sich aber nie richtig durchsetzen können.
Außerdem trat letztes Jahr Ellen Bornowsky als Präsidentin zurück, und Tanja Frauenstein wurde zur neuen Präsidentin gewählt. Beide unterstützten das deutsche Konsulat bei der Evaluierung des jährlichen Sprachwettbewerbs.
Eines unserer Ziele im vergangenen Jahr war es, an der jährlichen BCATML (Konferenz für moderne Sprachen) mehr Vorträge für Deutschlehrer(innen) anbieten zu können. Margaret Ronsano und Michele Britton führten eine interessante "Power Point"-Präsentation zum Thema "Eine virtuelle Reise durch Deutschland" vor.
In den meisten Provinzen nehmen die Schülerzahlen an den öffentlichen Schulen immer mehr ab, so dass einige Programme schwer mit dem Überleben zu kämpfen haben. An den Samstagschulen scheinen die Schülerzahlen relativ stabil zu sein. Dort wird auch das Sprachdiplom I und II und die ZDP angeboten.
Karli Süss hat bei einem seiner Besuche Strategien zur "Werbung" für die deutschen Sprache vorgestellt. Der T-Shirt-Wettbewerb wäre bestimmt keine schlechte Idee.
CAUTG-Bericht an die CATG
Rüdiger Mueller, Guelph
Da es sich bei diesem Bericht um meinen ersten als Delegierter der CAUTG zur CATG handelt und ich diese Position erst nach unsrer Tagung von 2003 in Halifax übernommen habe, wird er kurz ausfallen.
Im Ganzen haben sich die Einschreibezahlen an den 25 kanadischen Universitäten 2002/ 2003 im Vergleich zum Vorjahr um 1.169 auf 20.473 erhöht. Davon waren 11.228 Studenten in Sprachkursen eingeschrieben (vs. 10.593, 2001/ 2002).
Im Jahr 2002 hatte die CAUTG mit 232 deutlich mehr Mitglieder als im Vorjahr (197).
Die CAUTG-Tagung von 2004 wird vom 29. Mai bis 1. Juni 2004 an der University of Manitoba, Winnipeg, stattfinden. Weitere Informationen zu dieser Konferenz finden sich auf der Webseite der CAUTG, deren neue Adresse http://www.cautg.org lautet.
Ab 2004 übernimmt Frau Dr. Kim Fordham, Augustana UC, die Stelle der Leiterin des von der CAUTG gesponsorten Canadian Summer School in Germany Programms (http://web.uvic.ca/geru/cssg). Es handelt sich hierbei um ein sehr erfolgreiches Programm, das sechswöchige, intensive Sprachkurse auf Universitätsniveau in Kassel, Deutschland, anbietet.
Das CAUTG-Nomination Committee hat Frau Dr. Jane Curran, Dalhousie University, und Frau Dr. Florentine Strzelczyk, University of Calgary, als Members of the Board vorgeschlagen. Frau Dr. Curran soll die atlantischen Provinzen und Frau Dr. Strzelczyk Alberta/Britisch Kolumbien vertreten.
Wolfgang Krotter, Montreal
Seit 1972 gibt es die „Wörter des Jahres“ ; seit 1978 werden sie im Sprachdienst (Herausgeber: Gesellschaft für deutsche Sprache) regelmäßig publiziert.Ausgewählt werden Wörter und Ausdrücke, die in der öffentlichen Diskussion des betreffenden Jahres besonders wichtig waren.
Im folgenden Quiz geht es um Themen und „Themchen“, die in den letzten 30 Jahren so viele Schlagzeilen gemacht haben, dass sie einen bleibenden Eindruck in der Sprache und bei den Sprachbeobachtern hinterlassen haben.
1. Das Wort des Jahres 1985 lautete „Glykol“, …
- a. … weil sich mit dieser Substanz zum
ersten Mal so wirkungsfähige Bomben bauen ließen, dass diese
durch Abschreckung zum Anfang des Endes des kalten Krieges wurden.
b. ... weil das Süßen vor allem von österreichischen Weinen durch das billige Frostschutzmittel Glykol einen Skandal auslöste, der die österreichische Weinwirtschaft praktisch zum Stillstand brachte.
c. … weil der in diesem Jahr erfundene Treibstoffzusatz Glykol den Wirkungsgrad von Verbrennungsmotoren praktisch über Nacht verdoppelte.
2. Wie lautete der Name des „Kremlfliegers“ (unter den Wörtern des Jahres 1987), der 1987 mit seinem Kleinflugzeug auf dem Roten Platz in Moskau landete?
- a. Matthias Rust
b. Karl-Heinz Schreiber
c. Uri Geller
3. Wie hoch war das „Begrüßungsgeld“ (unter den Wörtern des Jahres 1989), das 1989 an DDR-Bürger einmalig ausbezahlt wurde? Wo wurde es ausbezahlt?
- a. 200
Mark; ausbezahlt in allen Kaufhäusern
b. 100 Mark; ausbezahlt in allen Finanzämtern
c. 100 Mark; ausbezahlt in allen Rathäusern, Banken und Sparkassen
4. Unter „Peanuts“ (unter den Wörtern des Jahres 1994)
versteht man in Deutschland seit 1994 nicht nur die
entsprechende Nuss-Sorte, sondern auch…
- a. … eine subjektiv
als relativ klein
empfundene Geldmenge.
b. … eine auf ehemaligem DDR-Boden erfolgreich gezüchtete Hülsenfrucht, die Erdnüssen äußerlich gleicht.
c. … einen besonders kleinen Autotyp von BMW.
5.
Beim berühmten „Elchtest“ (unter den Wörtern des
Jahres 1997) wurde getestet, ...
- a. …wie viele Elche
pro Jahr aus Norwegen
abwandern. Aufgrund der niederschmetternden Ergebnisse des Tests wurde
in weiten Teilen Skandinaviens ein Elch-Notstandsgesetz erlassen.
b. …wie stabil sich ein Auto im extremen Zickzack-Kurs verhält. Dabei kippte ausgerechnet ein Auto der Marke Mercedes bei extremer Belastung um. Dies sorgte für ein großes Presse-Echo.
c.…wie hoch der Intelligenzquotient bei Vertretern der Elchfamilie (Alces alces Linnaeus) im Schnitt ist. Der Test wurde notwendig, nachdem Wissenschaftler beobachtet hatten, dass sich verschiedene Elcharten untereinander mit hieroglyphenartigen Sprachzeichen verständigten.
6.
Von wem stammte der Ausruf „Ich habe fertig!“ (unter
den Wörtern des Jahres 1998) und zu welchem Anlass
wurde er getätigt?
- a. Helmut
Kohl, deutscher Bundeskanzler von 1982
bis 1998, rief diese Worte aus, nachdem er in der Bundestagswahl 1998
von Gerhard Schröder besiegt worden war.
b. Giovanni Trapatoni, ehemaliger Trainer des FC Bayern München, brüllte diese Worte am Ende einer inzwischen legendären Pressekonferenz. Er machte damit seinem Ärger über die Faulheit einiger seiner Spieler Luft.
c. Hans Nebelhuber, SPD-Bürgermeister der bayerischen Kleinstadt Gunzelshofen, gab mit diesem Ausspruch bei einer viel beachteten Pressekonferenz seinen Rücktritt wegen des Kruzifix-Urteils bekannt.
7.
Mit dem Ausruf „Und das ist (auch) gut so!“ (unter den
Wörtern des Jahres 1999) hat sich welche Person zu
welcher Gelegenheit unsterblich gemacht?
- a. Klaus
Wowereit, regierender Bürgermeister
von Berlin, „outete“ sich mit diesem Satz als homosexueller
Mann.
b. Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsmitglied des FC Bayern München, kommentierte damit die Tatsache, dass sein Verein erneut deutscher Meister wurde.
c. Helmut Kohl, Ex-Bundeskanzler, fiel bei einer Pressekonferenz mit diesem Satz einem Journalisten ins Wort, der einen Satz so begann: „Das 20. Jahrhundert neigt sich seinem Ende entgegen...“
8.
Beim in Deutschland äußerst populären
„simsen“
(unter den Wörtern des Jahres 2001) macht man was
genau?
- a. Man
„simst“ (also: schießt,
eliminiert und sammelt Punkte) beim sehr populären Computerspiel
SIMS (Super Intensive Monster Search) auf elektronische Wesen, die
über den Computerbildschirm tanzen.
b. Man „simst“, indem man auf seinem „Handy“ Textnachrichten, also SMS (Short Message Service) verschickt.
c. Man „simst“, indem man bei einer neuartigen Sportart mit einem Plastikschläger auf „Simse“ schlägt.
9.
Beim „PISA-Schock“ (unter den
Wörtern des Jahres
2002) waren viele Deutsche deshalb so schockiert, …
- a. … weil plötzlich
der Schiefe Turm
von Pisa für die Millionen deutscher Italien-Touristen auf Grund
der größer werdenden Kippgefahr nicht mehr zugängig
war.
b. weil bei dem in Deutschland sehr populären Fiat-Automodell PISA gröbste Konstruktionsfehler entdeckt wurden, die zu schwersten Unfällen hätten führen können.
c. … weil bei einer weltweiten OECD-Studie zur Effizienz der Bildungssysteme namens PISA (PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT) das deutsche Bildungswesen entgegen den Erwartungen vieler Beobachter im Schnitt nur im Mittelfeld rangierte.
10.
Wie lautet die gängige Aussprechweise des
Begriffs
„Agenda 2010“ (unter den Wörtern des Jahres 2003)
und was versteht man darunter?
- a. Aussprache:
„Agendazwanzigzehn“. Es
handelt sich dabei um ein Reformpaket der Bundesregierung, das einen
Umbau der sozialen Sicherungssysteme in Deutschland beinhaltet.
b. Aussprache: „Agendazweitausendzehn“. Es handelt sich dabei—in Anlehnung an Stanley Kubrick´s „2001: Odyssee im Weltraum“—um ein Science Fiction-Filmprojekt eines viel versprechenden deutschen Nachwuchs-Regisseurs.
c. Aussprache: „Agendazweinulleinsnull“. Es handelt sich dabei um eine Reality-Show des österreichischen Fernsehens ORF, bei der 20 Teilnehmerinnen um 10 Jury-Plätze beim Grand Prix d´Eurovision kämpfen.
Lösungen: 1b, 2a, 3c, 4a, 5b, 6b, 7a, 8b, 9c, 10a
 On a Saturday morning in
Fredericton,
I took several snapshots
of what New Brunswickers think of when they think of German
culture in the region.
One of the main associations with
German ness is a culinary one.
There are several very popular
German restaurants in the region, and by German,
I mean Bavarian. In Fredericton, Sackville,
Moncton and Stanley, these are popular places to eat Schnitzel or
Rouladen and drink beer (Schades, Schnitzel Haus).
One quickly notices the strong
German presence at the Fredericton Farmer’s Market—perhaps
a quarter of the stands are run by German immigrants. There are
three German bakers there,
two German sausage stands, and a
German immigrant woman who smokes fish,
pickles herring, makes Rollmops,
and brings these down from the Miramichi. The
vendors at the Farmer’s Market are among the few visual cues of
German identity for New Brunswickers.
On a Saturday morning in
Fredericton,
I took several snapshots
of what New Brunswickers think of when they think of German
culture in the region.
One of the main associations with
German ness is a culinary one.
There are several very popular
German restaurants in the region, and by German,
I mean Bavarian. In Fredericton, Sackville,
Moncton and Stanley, these are popular places to eat Schnitzel or
Rouladen and drink beer (Schades, Schnitzel Haus).
One quickly notices the strong
German presence at the Fredericton Farmer’s Market—perhaps
a quarter of the stands are run by German immigrants. There are
three German bakers there,
two German sausage stands, and a
German immigrant woman who smokes fish,
pickles herring, makes Rollmops,
and brings these down from the Miramichi. The
vendors at the Farmer’s Market are among the few visual cues of
German identity for New Brunswickers.  If I ask
them about German immigration to Canada, one or two
might know of the Kitchener-Waterloo area,
where the biggest
Oktoberfest outside of Germany takes place every year.
A very
few might know about the German influence in Nova Scotia’s
Lunenburg region.
When I ask them why they have chosen to
learn German,
a few will tell me that they have German family
background,
but many will tell me that they are filling a language
requirement and liked the idea of German because it seemed different
from French or Spanish.
None of them know about the
German history and economic impact in the province,
and very
few realize that knowledge of German will be useful in their
field of study or their future career prospects.
I will return to the
development of German Studies in the region shortly,
but first, I
will give you an overview of German history and immigration,
as well as German tourism.
If I ask
them about German immigration to Canada, one or two
might know of the Kitchener-Waterloo area,
where the biggest
Oktoberfest outside of Germany takes place every year.
A very
few might know about the German influence in Nova Scotia’s
Lunenburg region.
When I ask them why they have chosen to
learn German,
a few will tell me that they have German family
background,
but many will tell me that they are filling a language
requirement and liked the idea of German because it seemed different
from French or Spanish.
None of them know about the
German history and economic impact in the province,
and very
few realize that knowledge of German will be useful in their
field of study or their future career prospects.
I will return to the
development of German Studies in the region shortly,
but first, I
will give you an overview of German history and immigration,
as well as German tourism.